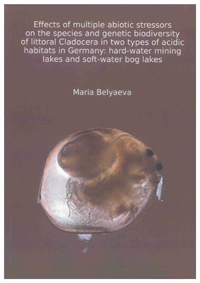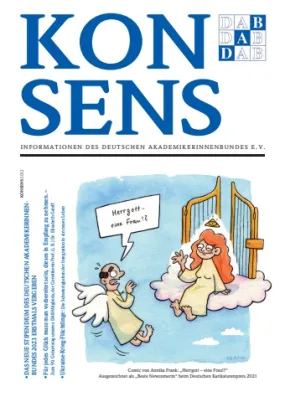Vom DAB geförderte Dissertationen
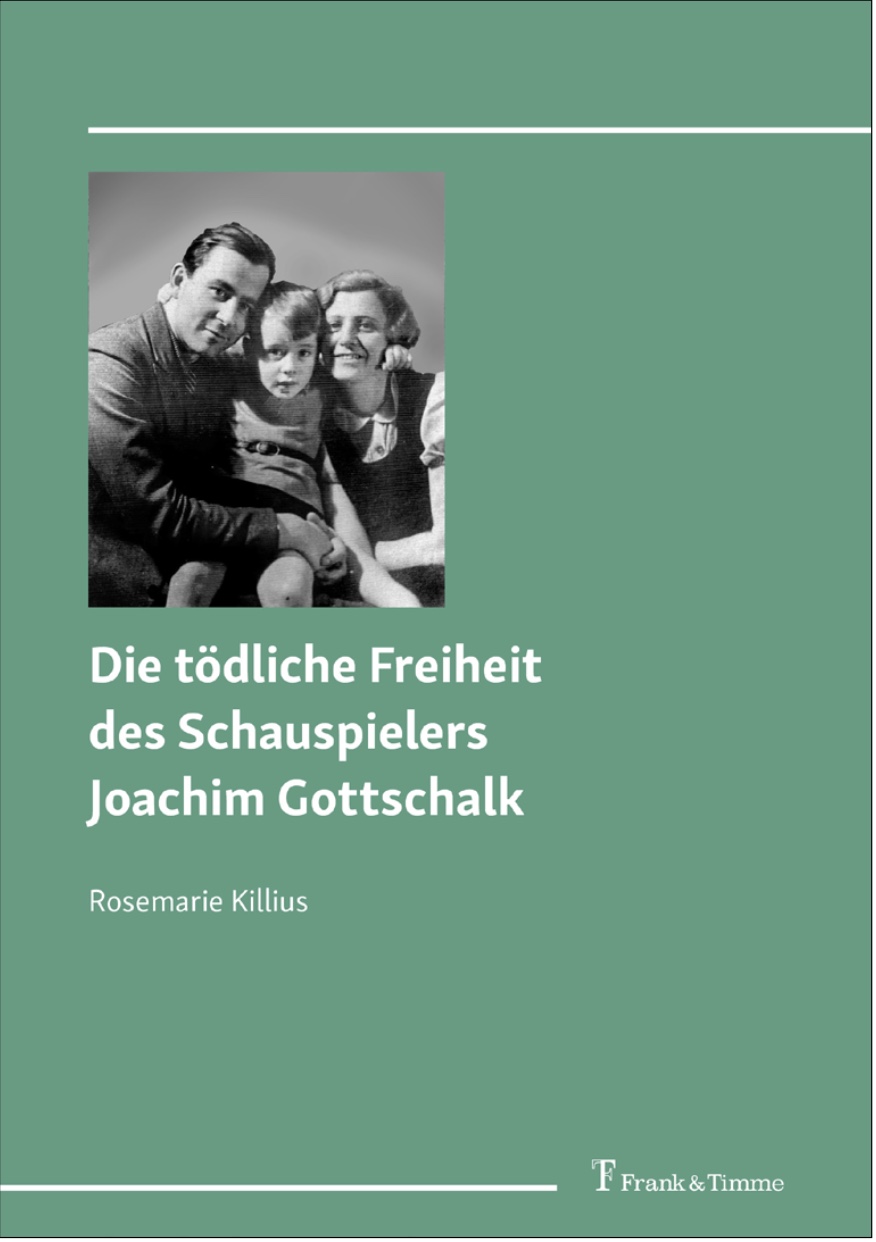
Die tödliche Freiheit des Schauspielers Joachim Gottschalk
Rosemarie Killius
248 Seiten, gebunden, mit zahlreichen Abbildungen
Buch: ISBN 978-3-7329-1133-2, EUR 36,00
E-Book: ISBN 978-3-7329-8782-5, EUR 46,00
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Zum Inhalt
Joachim Gottschalk (1904–1941) lebt noch heute in der Erinnerung mancher Menschen als großer Filmschauspieler der 30er Jahre. Die sieben Filme mit ihm als Hauptdarsteller waren damals europaweit bekannt. Joachim Gottschalk als genialen Theaterschauspieler, der als Superstar auf den Frankfurter Römerbergfestspielen agierte, kennen hingegen nur noch wenige aus den Erzählungen ihrer Eltern.
Die Historikerin Rosemarie Killius hat seinem Lebensweg nachgespürt. Gespräche mit Weggefährten, Briefe und Tagebücher zeichnen ein eindrucksvolles Bild seines Lebens. Aus der Stadt seiner größten Bühnenerfolge wurde Gottschalk von den Nazis wegen seiner Solidarität zu seiner jüdischen Ehefrau verjagt. Als er schließlich in Berlin dem Druck des „Schirmherrn des deutschen Films“, Joseph Goebbels, nicht mehr standhalten konnte, wählte er mit seiner Familie den Freitod. Dieses Buch ist mithin ein wichtiger Beitrag, die Erinnerung an einen außergewöhnlichen Menschen wachzuhalten.
Zur Autorin
Dr. phil. Rosemarie Killius hat u. a. in Madrid und Paris Geschichte sowie französische und spanische Philologie studiert und in Biografieforschung promoviert. Sie publiziert zur Zeit des Nationalsozialismus und der Weltkriege. Ihr Engagement in Russland wurde mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Als Expertin für die Filmgeschichte der 1930er bis 1950er Jahre ist sie freie Mitarbeiterin bei der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und am Deutschen Filminstitut/Filmmuseum (DFF).

Frauen in Spitzenpositionen
Role Models der Finanzbranche
188 Seiten, Broschur
€ 24,00
ISBN: 978-3-96251-232-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Mehr Frauen an die Spitze!
Braucht es die Quote für mehr Frauen in Führungspositionen? Welche Mittel stehen noch zur Verfügung, um mehr Parität in den oberen Managementetagen von Unternehmen zu erreichen? Wie wichtig sind Vorbilder, die anderen Mut machen, ihrem Beispiel zu folgen?
In ihrem achten Buch „Frauen in Spitzenpositionen“ versammelt Petra Nabinger Porträts von Frauen in der Finanzwelt, die es in dieser männerdominierten Branche bis nach oben geschafft haben. Die interviewten Frauen berichten von Stolpersteinen, Schlüsselmomenten, Netzwerken sowie der eigenen Motivation und gewähren auf diese Weise ehrliche und authentische Einblicke in ihre Laufbahnen. Das übergreifende Fazit der Frauen lautet: Auf die eigenen Stärken schauen und schon in frühen Jahren mehr fordern. Beiträge von Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen bieten Empfehlungen und Tipps für den individuellen Karriereweg.
Die Autorin:
Petra Nabinger ist seit 2008 in verantwortungsvoller Position in der Sparkasse tätig. Seit 2013 schreibt sie Bücher und Artikel zum Thema Chancengerechtigkeit. 2019 wurde sie als „Role Model of the Year“ für den Fondsfrauen Award und im Jahr 2022 vom Deutschen Akademikerinnenbund für den Anne-Klein-Frauenpreis der Heinrich-Böll-Stiftung nominiert. Als Netzwerkerin engagiert sie sich u. a. beim Deutscher Akademikerinnenbund e.V. und dem Sparkassennetzwerk S-FiF.
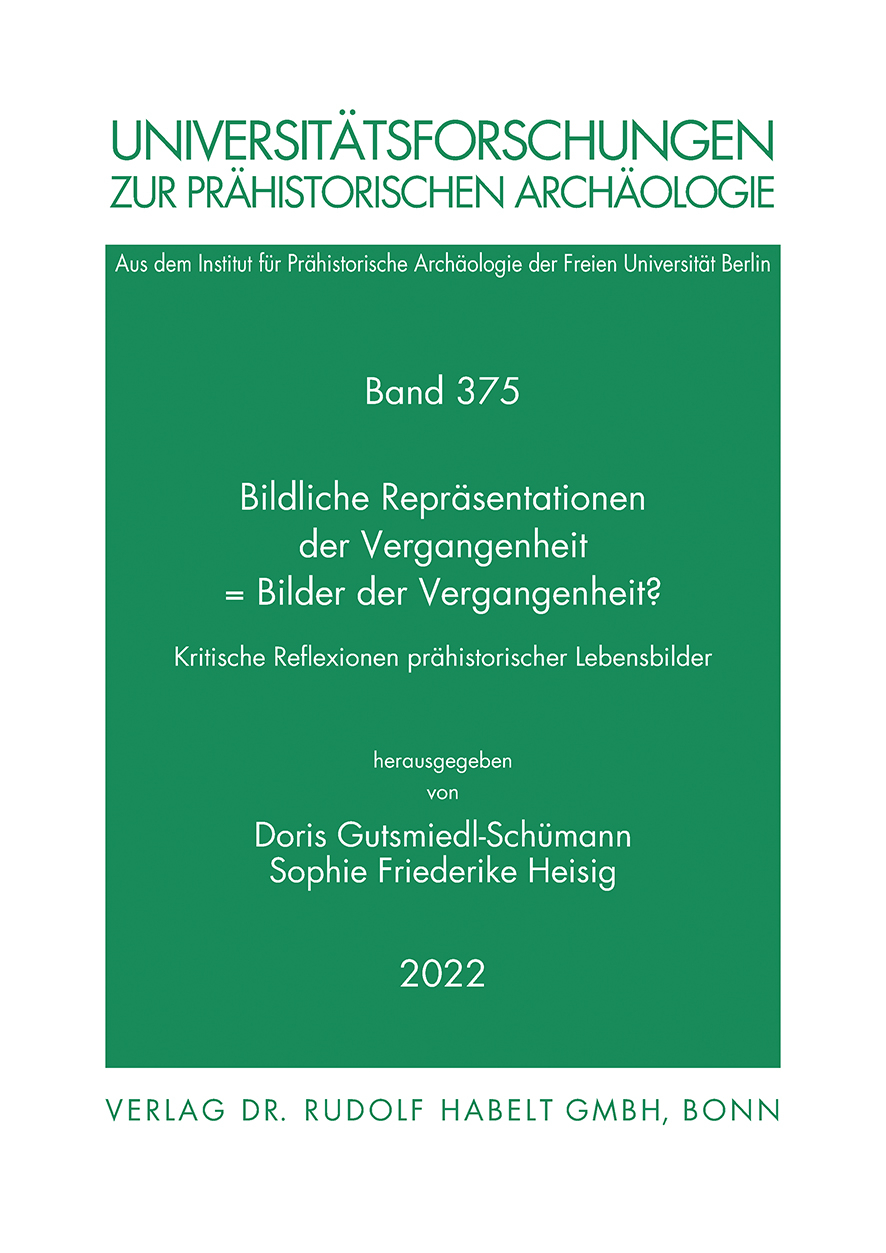
Bildliche Repräsentationen der Vergangenheit = Bilder der Vergangenheit?
Kritische Reflexionen prähistorischer Lebensbilder
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
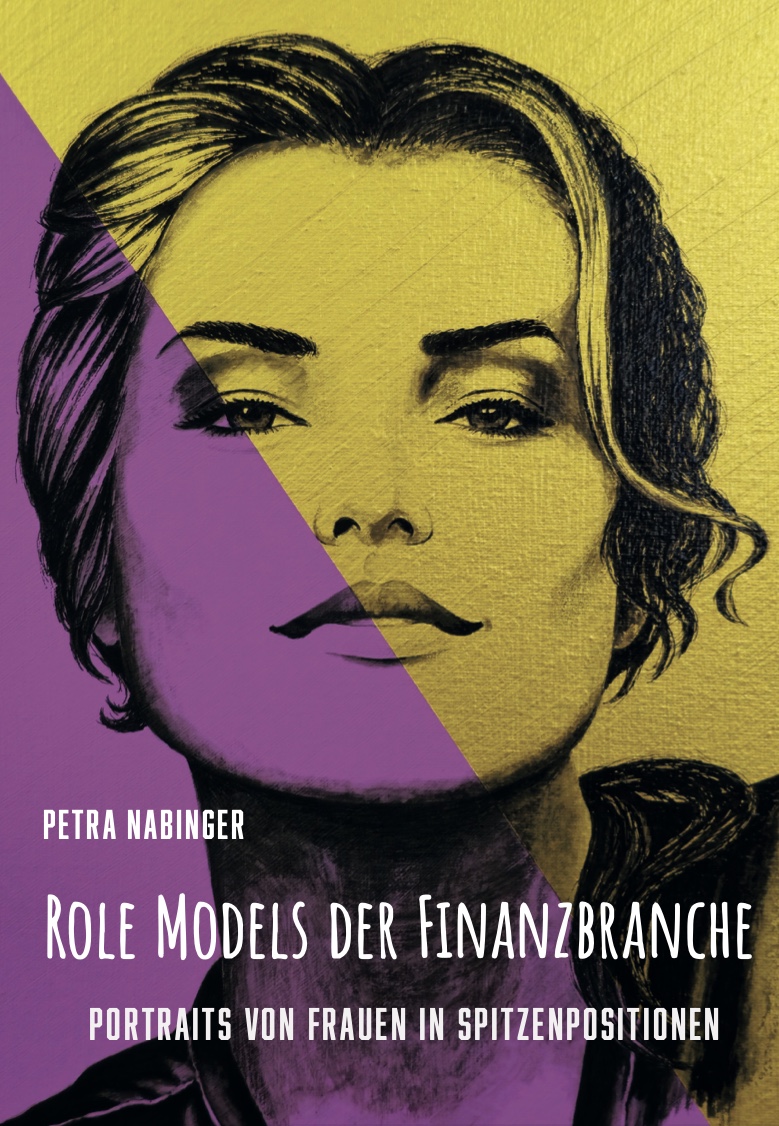
„Role Models der Finanzbranche – Portraits von Frauen in Spitzenpositionen“
Petra Nabinger, Juni 2024 im Littera Verlag Bad Dürkheim, ISBN 978-3-945734-51-3, 225 Seiten, Hardcover, 24,90 €
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
„Es gibt keine Grenzen für das, was wir als Frauen erreichen können.“
Dieses Zitat von Michelle Obama ist ein wunderbares Statement.
Es passt perfekt zu diesem Buch.
Frauen aus der immer noch männerdominierten Finanzbranche berichten über ihren Weg in Spitzenpositionen.
Sie erzählen über Stolpersteine, über Schlüsselmomente, das Netzwerken und die eigene Motivation.
Lassen Sie sich von diesen Role Models inspirieren und blicken Sie in facettenreiche Laufbahnen hinein,
die dazu ermutigen, auf die eigenen Stärken zu vertrauen und mehr zu fordern.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und grenzenlose Kreativität für Ihre eigenen Zukunftspläne!
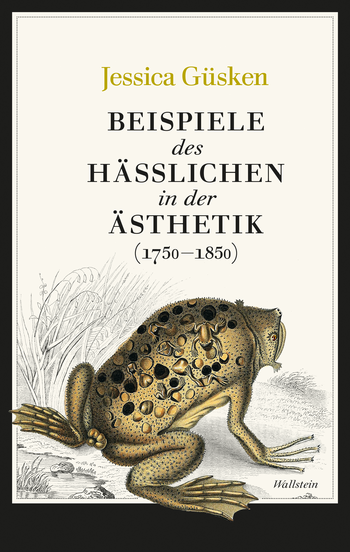
Beispiele des Hässlichen in der Ästhetik (1750–1850)
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Über das Hässliche lässt sich nur in Beispielen sprechen: Mit ihnen betritt man die Systemgebäude der Ästhetik durch einen Seiteneingang, der über deren Ausschlüsse und Grenzen letztlich mitten hinein führt in die normative Konstitution des modernen Geschmacks.
Im Rahmen der philosophischen Ästhetik (1750-1850), deren erklärter Leitbegriff die Schönheit ist, erscheint das Hässliche als randständiger und eigentümlich prekärer Begriff. Auch die Beispiele sind als solche etwas, das abseits des Systematischen liegt. Jessica Güsken widmet sich den Entwürfen der Hässlichkeit aus Perspektive der Beispiele, die in den Texten der Ästhetik zirkulieren und als vermeintlich »bloßes Beiwerk« philosophischer Theorie bislang keine genauere Untersuchung erfahren haben. Dabei ist die Ästhetik darauf angewiesen, Beispiele zu geben: Sie avancieren zu unverzichtbaren Agenten der Herstellung und Sicherung von Evidenz. Zugleich haben sie den Übergang von der Theorie in die Praxis ästhetischen Urteilens zu vermitteln, sodass Beispiele als Medien sichtbar werden, die aus dem Text herausführen, Körper und Sinne in Bewegung setzen und dabei auf die Ausbildung des ästhetischen Subjekts als »Mensch von Geschmack« sowie dessen disziplinierende Einübung zielen. Die diskursanalytische Untersuchung erlaubt neue Einsichten in die Konstitution der modernen Ästhetik und die Kehrseiten ihres humanistischen Geschmacksideals, und fordert dabei auch immer wieder zu der Frage heraus, inwieweit sich der ästhetische Blick auf Oberflächen, Haut und Körper bis heute von der normativen Exklusivität des klassi(zisti)schen Schönheitsbegriffs entfernt hat.
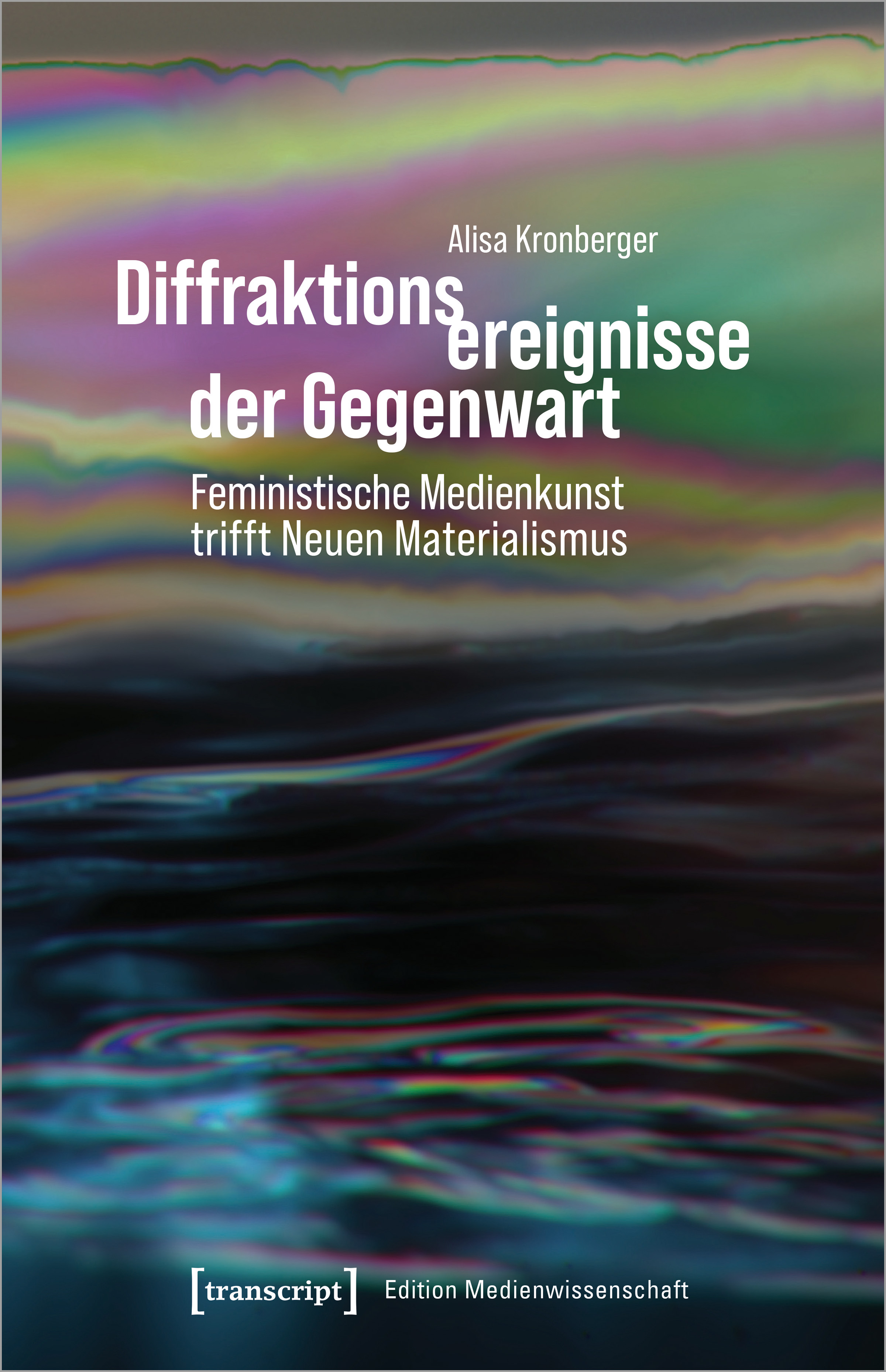
Diffraktionsereignisse der Gegenwart
Feministische Medienkunst trifft Neuen Materialismus
(PDF in Open Access zugänglich, www.transcript-verlag.de/978-3-8376-6131-6/diffraktionsereignisse-der-gegenwart/)
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Diffraktionsereignisse handeln im Kern von einem affektiv durchtränkten Zustande-Kommen eines komplexen, performativen Relationsmoments. Aus einer neo-materialistischen Perspektive spürt Alisa Kronberger dieses Phänomen in der feministischen Gegenwartskunst auf. Sie fragt erstmalig dezidiert nach der Aktualität der historischen Nähe zwischen Feminismus und Videokunst und bietet – an den Schnittstellen von Medien- und Kunstwissenschaft verortet – neue Einblicke in einen aktuellen Diskurs um einen Neuen Materialismus in der Medienkunst.
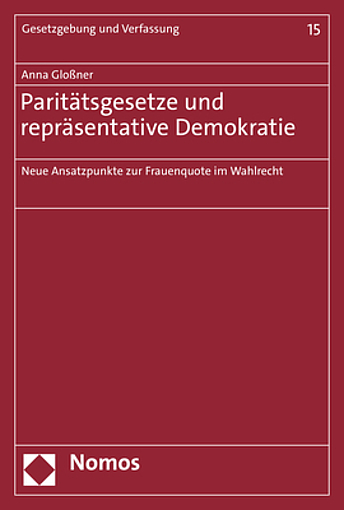
Paritätsgesetze und repräsentative Demokratie
Neue Ansatzpunkte zur Frauenquote im Wahlrecht
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Autorin untersucht die verfassungsrechtliche Zulässigkeit von paritätischen Wahlgesetzen unter Einbeziehung rechtstatsächlicher und rechtsvergleichender Aspekte. Dabei befasst sie sich mit grundlegenden und bislang ungeklärten Problemen des Grundgesetzes, insbesondere mit der demokratischen Repräsentation, der Konkretisierung der Wahlrechtsgrundsätze sowie deren Verhältnis zu den Gleichheitsrechten und Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG. Die Verfasserin kommt dabei zu dem Ergebnis, dass paritätische Wahlgesetze verfassungswidrig sind, da die intensiven Beeinträchtigungen, im Besonderen der Gleichheit der Wahl, Art. 38 Abs. 1 S. 1 GG, nicht gerechtfertigt werden. Paritätsregelungen könnten jedoch mit einer Grundgesetzänderung ermöglicht werden. Dem steht auch der unantastbare Kerngehalt des Demokratieprinzips, Art. 79 Abs. 3 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1, Abs. 2 GG, nicht entgegen. Das Werk zeigt letztlich einen eigenen Lösungsweg auf, der nicht an das Wahlrecht anknüpft, sondern Soft Law und die politische Debatte in den Vordergrund rückt.

Figures d'enfance
Représentations de l’enfant dans la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Avec son ouvrage L'enfant et la vie familiale sous l'Ancien Régime (1960), Philippe Ariès a découvert l'enfant comme objet de recherche interdisciplinaire. Cependant, une étude systématique sur le thème dans la littérature française des XVIIe et XVIIIe siècles n'a pas encore été entreprise. C'est pourtant à cette époque que le regard sur l'enfant change considérablement. La littérature des deux siècles joue un rôle décisif dans l'élaboration d'une nouvelle conception de l'enfance qui prépare et préfigure en bien des points le renouveau rousseauiste.
S'appuyant sur un appareil critique interdisciplinaire, qui invite à envisager l'enfant comme une construction de la réalité adulte dont les critères définitoires sont souples, l'autrice se propose d'étudier la représentation des personnages enfants dans un corpus de textes en prose. Il s'agit notamment d'analyser leur fonction dans l'économie du récit et leur implication dans les débats sociaux et philosophiques de l'époque.
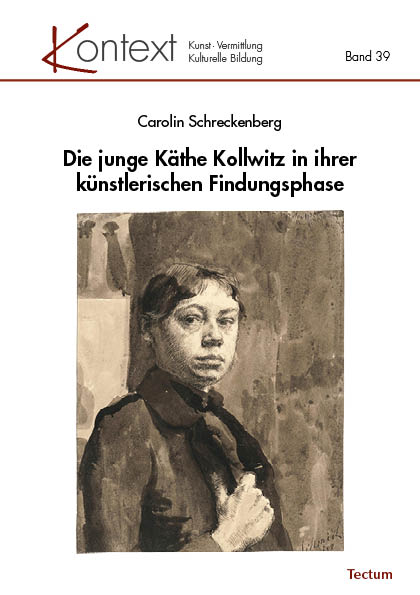
Die junge Käthe Kollwitz in ihrer künstlerischen Findungsphase
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Käthe Kollwitz (1867–1945) gab menschlichem Leid und sozialer Ungerechtigkeit eine ästhetische Form. Früh versuchte sie, mit ihrer Kunst denjenigen eine Stimme zu geben, die in der Gesellschaft oft an den Rand gedrängt und übersehen wurden, wie den Frauen und Kindern. Ihre Kunstwerke, die sich nach den Erschütterungen des 1. Weltkrieges (1914–1918) vor allem auch für den Frieden einsetzten, inspirieren bis heute Menschen weltweit. Obwohl Käthe Kollwitz weithin als bedeutende Künstlerin des 20. Jahrhunderts anerkannt ist, wurde ihren frühen Jahren weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Da hier bereits die Grundlagen für ein lebenslanges gesellschaftspolitisches Engagement gelegt wurden, ist dieses frühe künstlerische Werk von großem Interesse.
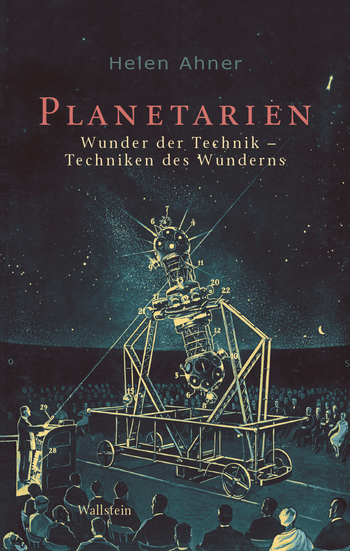
Planetarien
Wunder der Technik - Techniken des Wunderns
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Diese Kulturgeschichte des Planetariums erkundet das ambivalente Gefühl des Wunderns – und wie es den Blick auf die Welt veränderte.
Der Traum von der Eroberung des Weltraums inspiriert bis heute Wissenschaft und Technik, Kunst und Populärkultur. Der Erfüllung dieses Traums wähnten sich die Menschen ein Stück näher, die Anfang des 20. Jahrhunderts die ersten Planetarien der Welt besuchten.
Die ersten öffentlichen Planetariumsvorführungen im Jahr 1924 entfachten eine regelrechte Planetariumseuphorie und zogen das Publikum in den Bann der Sterne.
In ihrer Kulturgeschichte des Planetariums spürt Helen Ahner den Gefühlen, Wahrnehmungen und Erzählungen nach, die mit der Einrichtung der Planetarien in München, Jena, Wien und Hamburg einhergingen. Im Fokus stehen dabei die Technik-, Natur-, Körper- und Transzendenzerfahrungen, die den Planetariumsbesuch so besonders machten. Auf der Basis von über 900 Quellen zeigt sie, wie Planetarien zu Orten wurden, an denen sich Wissen, Wahrnehmen und Wundern verbanden und an denen die Menschen lernten, was es hieß, sich modern zu fühlen.
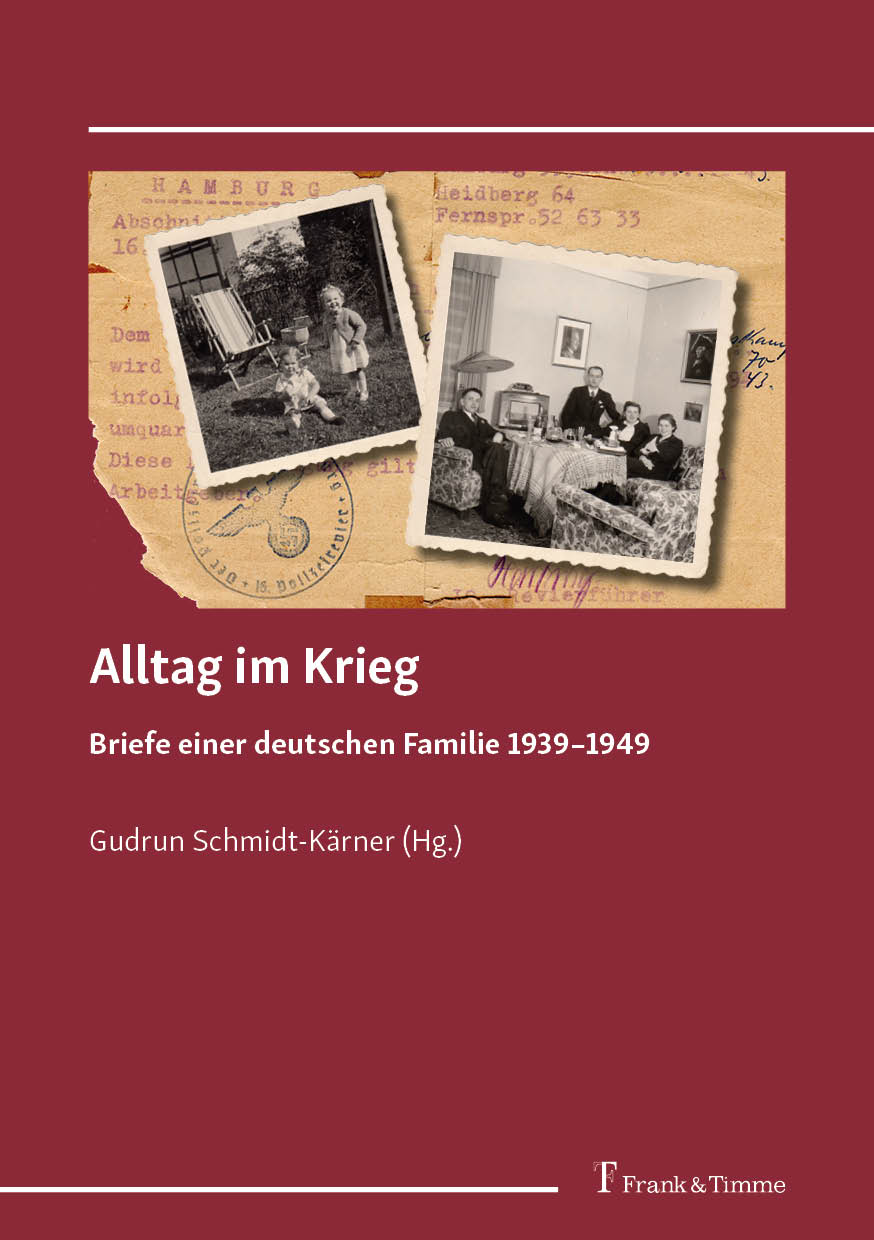
Alltag im Krieg
Briefe einer deutschen Familie 1939–1949
Gudrun Schmidt-Kärner (Hg.), Alltag im Krieg. Briefe einer deutschen Familie 1939–1949. Verlag Frank & Timme, Berlin, 2022.
280 Seiten, kartoniert, zahlreiche Abbildungen
Buch: ISBN 978-3-7329-0902-5, EUR 24,80
E-Book: ISBN 978-3-7329-9049-8, EUR 35,00
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Kaum etwas gewährt so authentische und persönliche Einblicke in das Leben früherer Generationen wie Briefe. Das gilt insbesondere für „schwierige Zeiten", wie den Zweiten Weltkrieg und die Nachkriegsjahre. Die hier versammelten Briefe einer weitverzweigten deutschen Großfamilie und ihrer Freunde stammen aus den Jahren 1939 bis 1949. Da die Briefpartner einander gut kannten und sich vertrauten, äußern sich die Schreibenden ehrlich und „ungeschminkt" über ihre Sorgen, Nöte und politischen Ansichten. Ihre Briefe sind einzigartige Zeugnisse des Alltags im Krieg. Sie offenbaren die unmittelbaren Folgen weltpolitischer Entwicklungen für individuelle Lebensentwürfe und zeugen vom schwierigen Neubeginn nach Kriegsende. Fotos aus dem Familienalbum geben den Personen ein Gesicht. Auf diese Weise wird Geschichte auf einer sehr persönlichen Ebene greifbar und zugänglich.
Herausgeberin: Prof. Gudrun Schmidt-Kärner, *1941, studierte nach einer Ausbildung und Tätigkeit als Erzieherin Musikalische Früherziehung und Grundausbildung an der Musikhochschule Lübeck. Sie lehrte dort mehr als dreißig Jahre lang elementare Musikpädagogik. Gudrun Schmidt-Kärner ist Mitbegründerin des Fördervereins für Jugendbildung und Wirtschaftsbeziehungen Norddeutschland-Kaliningrad e.V., der sich seit dreißig Jahren für Frieden und Völkerverständigung einsetzt, und war von 2001 bis 2006 Referentin für die Beziehungen zu Kaliningrad beim schleswig-holsteinischen Landtag.
Quelle: www.frank-timme.de/de/programm/produkt/alltag-im-krieg
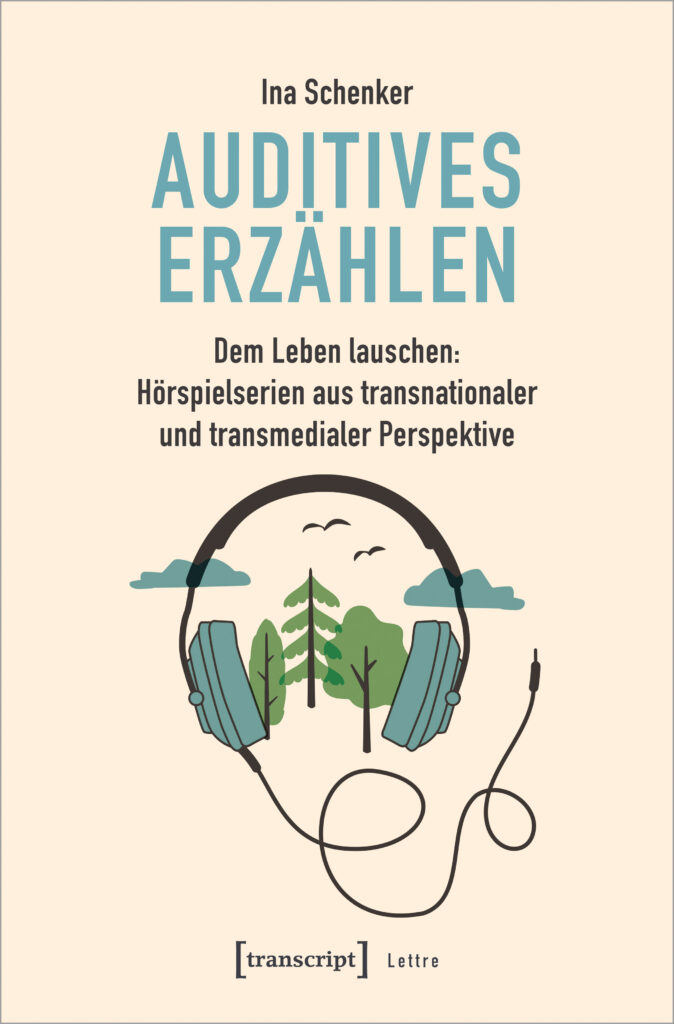
Auditives Erzählen.
Dem Leben Lauschen: Hörspielserien aus transnationaler und transmedialer Perspektive
Ina Schenker, transcript, 2022, 254 Seiten, 45€, ISBN: 978-3-8376-5860-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Hörspielserien erzählen Geschichten und zugleich von ihren Produktions- und Rezeptionskontexten. Ina Schenker setzt mit einer transnationalen und transmedialen Perspektive exemplarische radio dramas aus Ozeanien und Subsahara-Afrika in Bezug zur deutschsprachigen auditiven Medienkultur. Philologische Rahmungen werden agil, was nicht nur dem inhaltlichen Bezug zu Diskursen rund um Leben und Wissen geschuldet ist, sondern auch den Ausdrucksformen der Hörspielserien selbst. Auditives Erzählen ist vielschichtig: es regt an und auf, gibt Motivation und unterhält, weckt Emotionen und Geschichten – ist politisch und partizipativ.
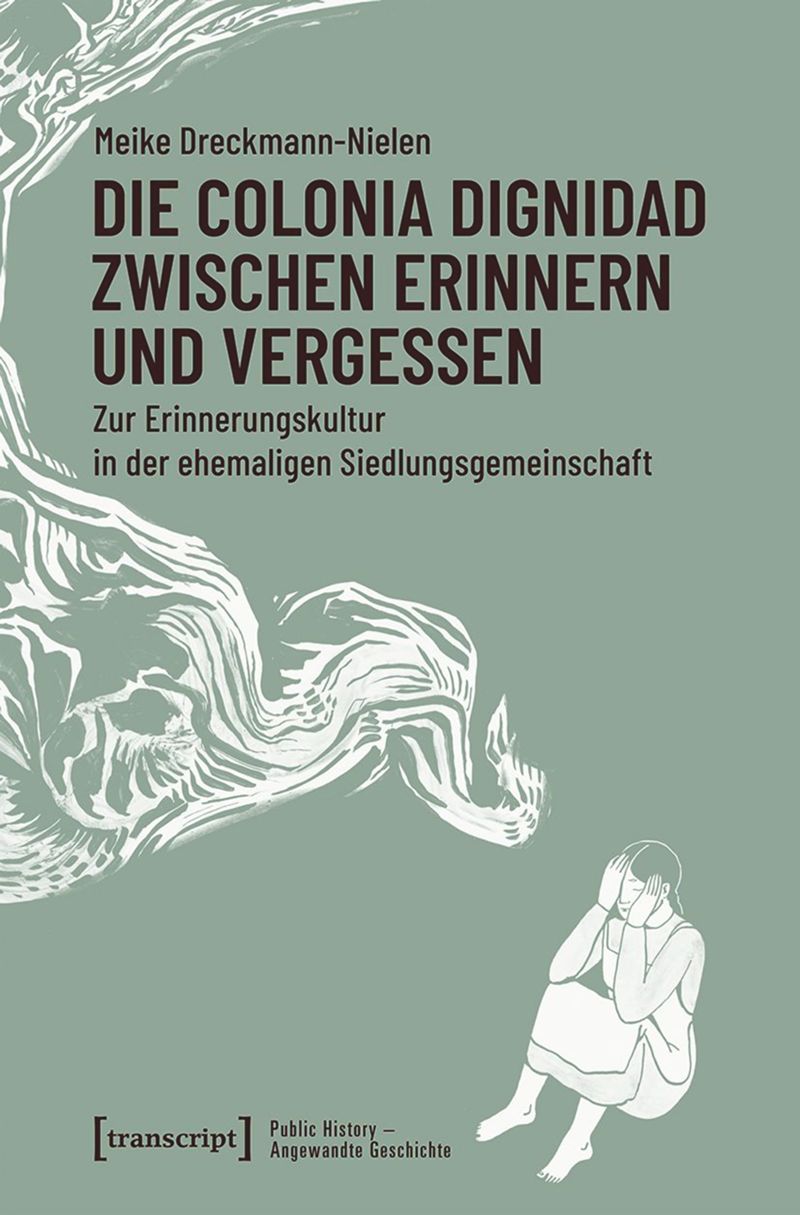
Die Colonia Dignidad zwischen Erinnern und Vergessen
Zur Erinnerungskultur in der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft
Meike Dreckmann-Nielen, transcript Verlag, 2022, 338 Seiten, 29,00 €, 978-3-8376-6213-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Colonia Dignidad erlangte wegen zahlreicher bis heute unaufgeklärter Menschenrechtsverbrechen internationale Bekanntheit. Dass einstige Mitglieder der deutschen Gruppe das historische Siedlungsgelände in Chile unter dem Namen »Villa Baviera« (deutsch: bayerisches Dorf) schrittweise zu einem touristischen Freizeitort umfunktioniert haben, sorgt angesichts der mangelnden Aufarbeitung für anhaltende Kritik. Meike Dreckmann-Nielen untersucht, wie sich einstige Mitglieder der Gruppe heute an ihre eigene Vergangenheit erinnern. In ihrer Studie ermöglicht sie einen intimen Einblick in komplexe erinnerungskulturelle Dynamiken im Mikrokosmos der ehemaligen Siedlungsgemeinschaft.
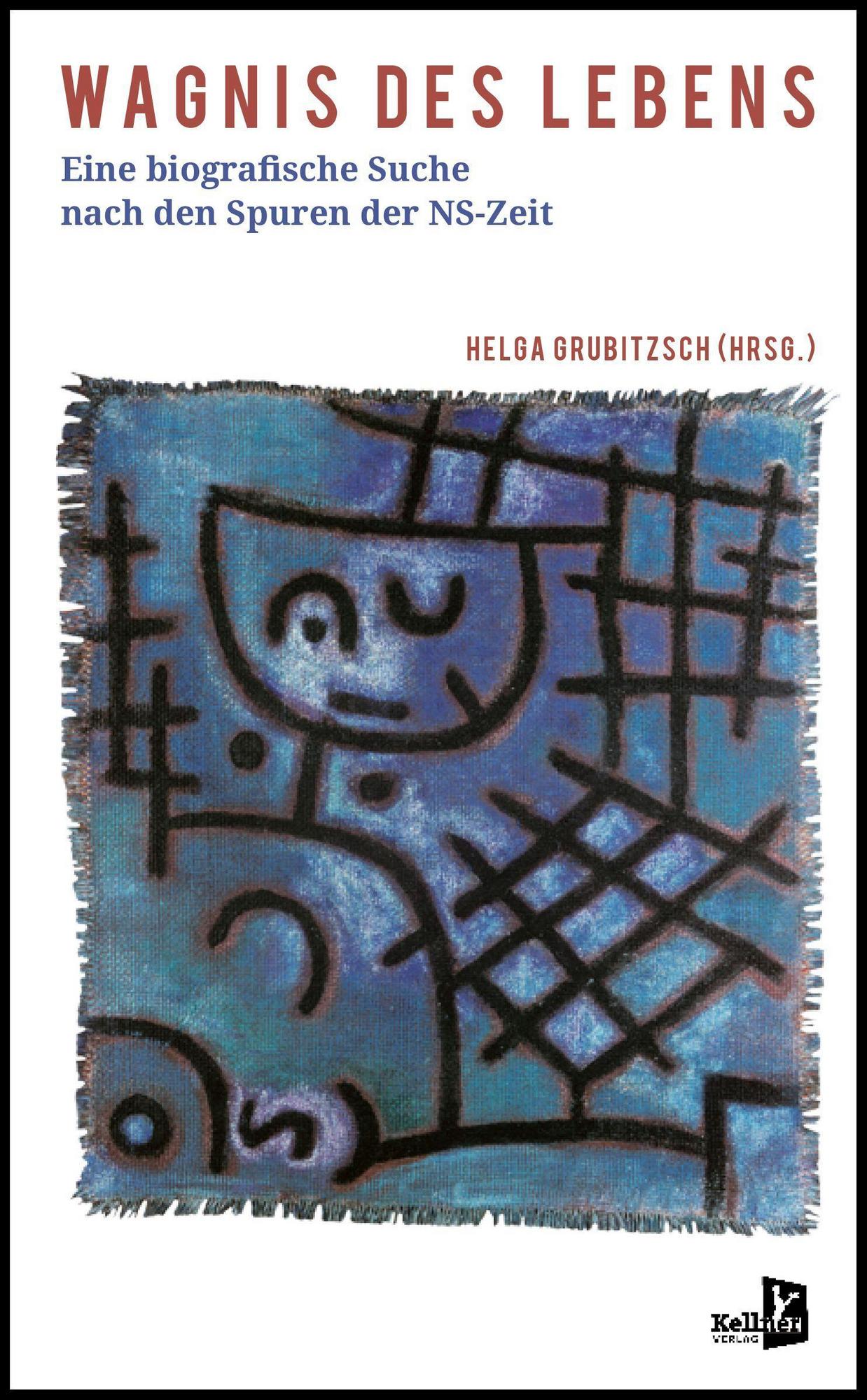
Wagnis des Lebens
Eine biografische Suche nach den Spuren der NS-Zeit
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Zeit des Nationalsozialismus hat Spuren hinterlassen. Spuren in den Kindern und Enkeln, die heute versuchen, ihre Eltern und Großeltern oder sich selbst zu verstehen, die Geschichten von Flucht und Widerstand aufspüren, die schreiben, um biografische und historische Wahrheiten zu entdecken und zur Sprache zu bringen. Sie stellen sich dem Grauen von Unterdrückung, Verfolgung, Überwachung, Mord und Krieg, aber auch dem Lebenshunger, dem Alltag und dem bewussten Vergessen. Sie haben Fragen an die Generation, die in dieser Zeit gelebt hat, unnachgiebig und forschend. Und sie lassen erkennen, was sie berührt und zur Auseinandersetzung auffordert.
Acht Autorinnen erzählen in ergreifender Weise über das Leben in der NS- und Kriegs-Zeit und thematisieren die Folgen für ihr eigenes Leben und Erleben. Sie haben zu ihren Eltern und Großeltern recherchiert, Fotos gesammelt, Gedichte verfasst und zu Widerstand und Emigration geforscht – aus heutiger Sicht ein berührendes und nachdenkliches Fazit zu einer Zeit, die immer noch nachwirkt.
Dieses Buch ist eine sehr persönliche und emotionale Sammlung von Erfahrungen und Recherchen von Nachkriegs-Kindern und Enkeln.
Aus Thalia.de
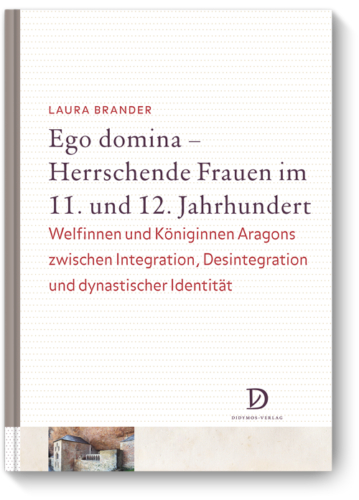
Ego domina – Herrschende Frauen im 11. und 12. Jahrhundert
Welfinnen und Königinnen Aragons zwischen Integration, Desintegration und dynastischer Identität
Laura Brander, Didymos-Verlag, 2022, 464 Seiten und 16 Tafeln mit 15 farbigen und 3 s/w Abbildungen, € 69,–, ISBN: 978-3-939020-34-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Ego domina befasst sich mit den herrschenden Frauen der welfischen Fürsten und der aragonesischen Königsfamilie im 11. und 12. Jahrhundert. Eine Frau gehörte im Mittelalter zwei Familien an: ihrer Herkunfts- und ihrer Ankunftsfamilie. Ehefrauen konnten in ihren Ankunftsfamilien als Identitätsstifterinnen wirken und das Selbstverständnis der Dynastie sowohl von außen als auch von innen und damit deren dynastische Identität beeinflussen. Das Buch zeigt, dass das Handeln einer Frau durch ihr Zugehörigkeitsgefühl zu ihren Familien bestimmt wurde sowie dadurch, mit welcher Familie sie sich identifizierte, in welche Familie sie sich integrierte und in welche Familie ihre Identität einfloss.
Zentral sind hierfür Fragen nach den Rollen, die Fürstinnen und Königinnen in ihren Familien wahrnahmen, ebenso wie nach den Funktionen, die jene Frauen für die Familien erfüllten. Auch besteht Klärungsbedarf, inwieweit sich die untersuchten Fürstinnen und Königinnen in ihre jeweilige Ankunftsfamilie integrierten und welche Einflussmöglichkeiten sich für adlige Frauen ergaben. Das Buch zeigt, dass ihr Einfluss abhängig von der eigenen Integration und dem Integrationswillen war. Dynastische Identität war keine Konstante, sondern im stetigen Wandel begriffen und wurde durch die Personen definiert, die die zwei wesentlichen Komponenten des Familienbewusstseins, Abstammung und Herrschaftslegitimation, transportierten.
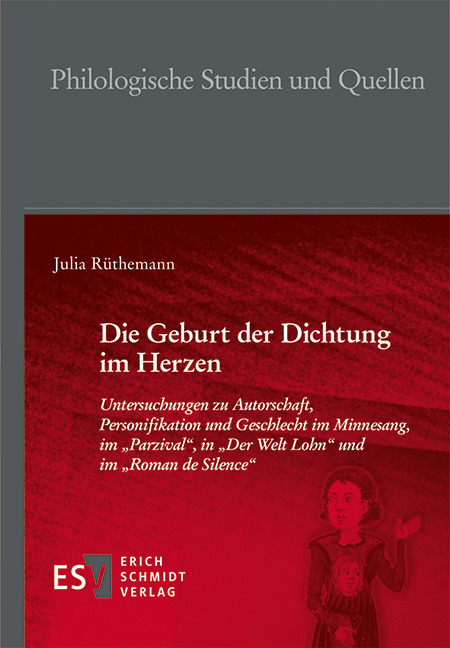
Die Geburt der Dichtung im Herzen
Untersuchungen zu Autorschaft, Personifikation und Geschlecht im Minnesang, im 'Parzival', in 'Der Welt Lohn' und im 'Roman de Silence
Julia Rüthemann, Erich-Schmidt-Verlag, 2022, 490 Seiten, 99.95 EUR, ISBN: 978-3-503-19589-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Frau Aventiure klopft an das Herz des Erzählers des "Parzival", Frau Welt veranlasst den Ritter Wirnt von Gravenberg in "Der Welt Lohn" durch eine Erkenntnis im Herzen zur Abkehr vom weltlichen Leben, die Minne(dame) drängt ins Herz des Minnesängers, der so zum Sang befähigt wird: das Muster einer Inspiration männlicher Dichter bzw. Protagonisten durch weibliche Personifikationen ist in der mittelalterlichen Literatur weit verbreitet.Die vorliegende Studie widmet sich den dieser Topik zugrunde liegenden, christlich geprägten Konzeptionen von Autorschaft und darin wirksamen mütterlichen Poetiken. Sie zeigt, dass in der Inszenierung literarischer Kreationsprozesse gerade auch durch männliche Autoren Vorstellungen von Schwangerschaft und Geburt 'fruchtbar' gemacht werden, die bereits in theologischen Denkfiguren, insbesondere der sogenannten Herzgeburt, angelegt sind. Die in Herz und Personifikation vermittelten re-produktiven Logiken prägen nicht nur die Poetiken, sondern auch das Erzählen. Der zweite Teil der Studie setzt sich daher mit dem narratologischen Status und den Gendercodierungen semi-personifikatorischer Figuren und teilallegorischer Räume auseinander.
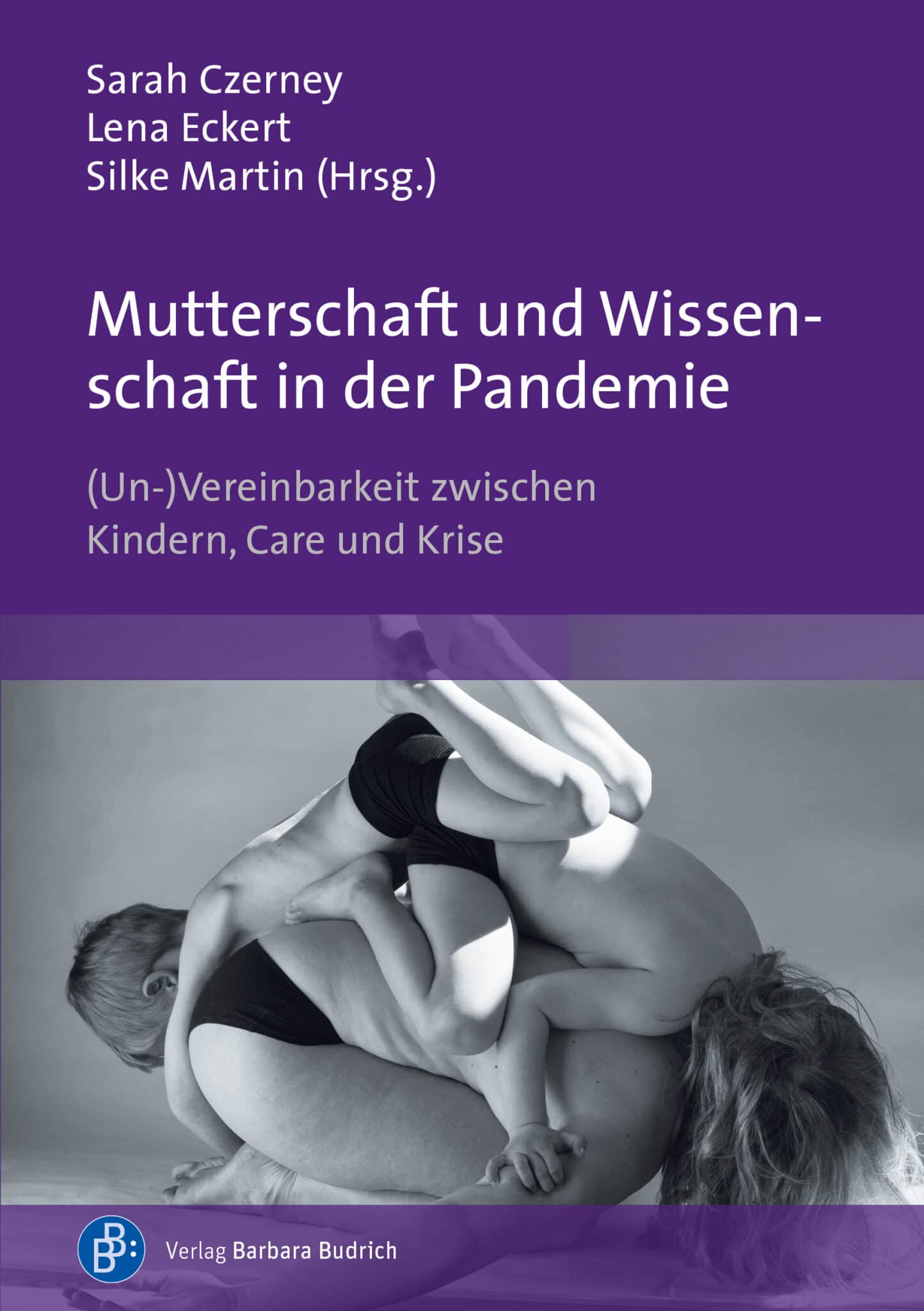
Mutterschaft und Wissenschaft in der Pandemie
(Un-)Vereinbarkeit zwischen Kindern, Care und Krise
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In der Pandemie spitzen sich gesellschaftliche Schieflagen und strukturelle Ungerechtigkeiten zu, so auch die berufliche Benachteiligung, die maßgeblich durch die Ungleichverteilung von Care-Arbeit begünstigt wird. Dieses Buch versammelt Erfahrungsberichte von Frauen*, die im Wissenschaftsbetrieb tätig sind und von ihren Erlebnissen während der Pandemie an deutschen Hochschulen berichten, und trägt somit zur Sichtbarkeit tabuisierter und individualisierter Erfahrungen bei. So werden die prekären Bedingungen, die sich während der Pandemie noch verstärkt haben, deutlich gemacht.
Die Pandemie spitzt gesellschaftliche Schieflagen und strukturelle Ungerechtigkeiten zu. So werden beispielsweise die Ungleichverteilung von Care-Arbeit, daraus folgende Benachteiligungen im Beruf, Lohnungerechtigkeiten oder der ungleiche Zugang zu Impfstoffen überdeutlich sichtbar. Eine weitere Zuspitzung lässt sich an der Figur der Mutter beobachten: So mehren sich die Stimmen, dass Mütter von kleinen Kindern die Verliererinnen der Pandemie sind. Noch mehr gilt das für mehrfachdiskriminierte Mütter und Alleinerziehende. Diese Benachteiligung lässt sich auch in der Wissenschaft beobachten. Während die Publikationen von Vätern in der Pandemie stiegen, sind die von Müttern eingebrochen. Eine ganze Generation von Frauen, v.a. Müttern, mitsamt ihrem Wissen könnten verloren gehen. Gleichzeitig ist Mutterschaft in der Wissenschaft merkwürdig unsichtbar, wenn man von üblichen Vereinbarkeitsdiskursen absieht. So sind Mütter zum einen im akademischen Betrieb spätestens ab nach der Promotion eine Seltenheit, zum anderen bildet Mutterschaft auch in feministischer Theorie und Geschlechterforschung eine Leerstelle und ein Tabu. Ein Manifest, das sich mit kritischen Perspektiven auf den Wissenschaftsmythos des allein und wettbewerbsorientierten, privilegierten und von Care-Arbeit befreiten Wissenschaftler beschäftigt, eröffnet eine neue Sichtweise auf eine mögliche Zukunft, nicht nur des Betriebes, innerhalb dessen Wissen generiert wird, sondern auch auf die Schwerpunktsetzungen von Erkenntnis und gesellschaftlicher Zukunft.
Quelle: shop.budrich.de/produkt/mutterschaft-und-wissenschaft-in-der-pandemie/
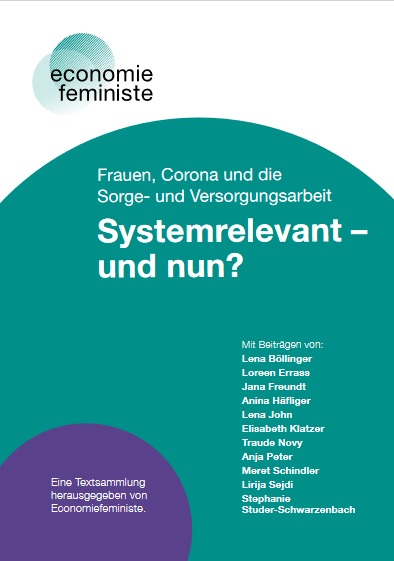
Frauen, Corona und die Sorge- und Versorgungsarbeit
Systemrelevant – und nun?
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Textsammlung Systemrelevant und nun? Frauen, Corona und die Sorge- und Versorgungswirtschaft beinhaltet eine fragmentarische Sammlung von feministischen Texten mit unterschiedlichen Zugängen und mit unterschiedlichen Schwerpunkten, von den Erfahrungen in der Pflege bis hin zum Thema häusliche Gewalt. Herausgegeben von Economiefeministe im September 2022.
Quelle und Zugang zur Textsammlung: economiefeministe.ch/wp-content/uploads/2022/09/2022_Ecofem_Systemrelevant-und-nun.pdf
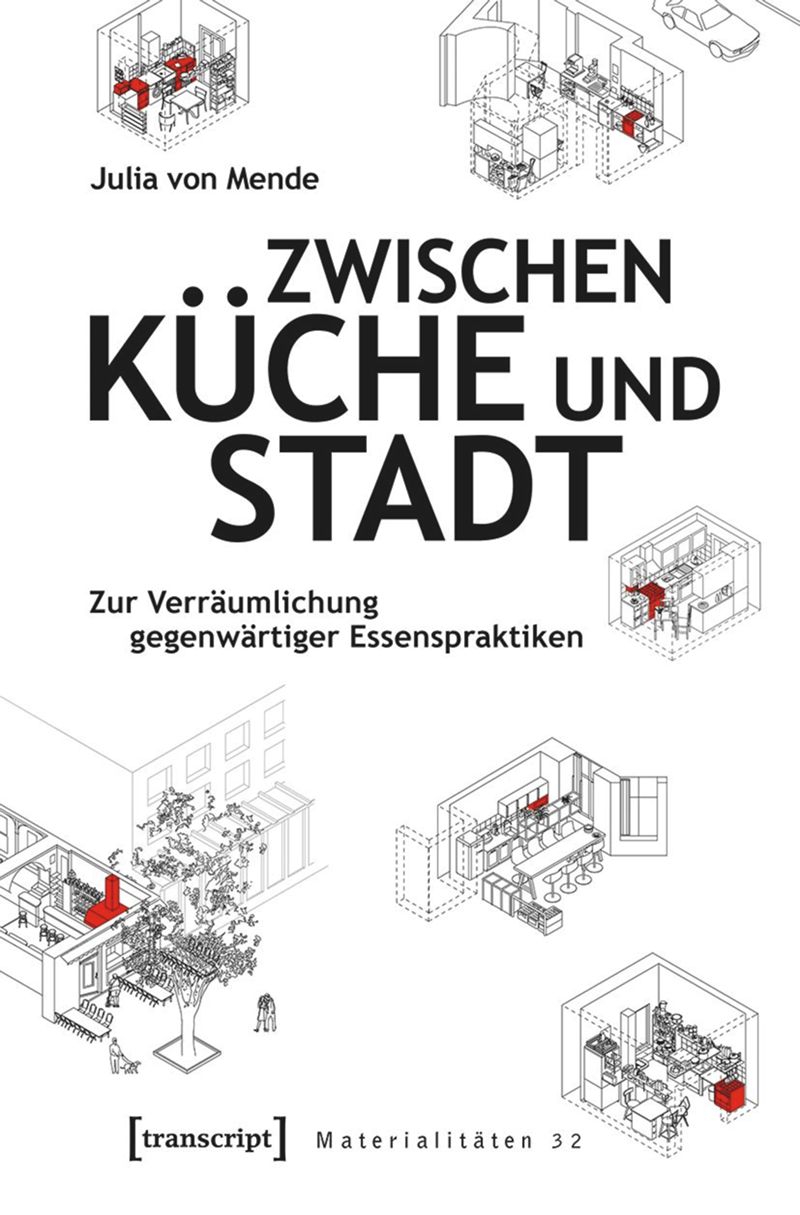
Zwischen Küche und Stadt
Zur Verräumlichung gegenwärtiger Essenspraktiken
Julia von Mende, 2022, 446 Seiten, 39,00 €, ISBN: 978-3-8376-5935-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Kochen und Essen sind medial omnipräsent und es gibt kaum noch einen Ort, an dem nichts gegessen oder getrunken wird - dabei bleibt die Küche im Zuhause zunehmend kalt. Dieses Paradox wirft Fragen an die räumlichen Zusammenhänge gegenwärtiger Essenspraktiken auf, denen Julia von Mende auf den Grund geht. Ihre Befragungen und zeichnerische Analysen führen die Leser*innen von Berliner Küchen an Orte außer Haus und in die Vergangenheit. Dabei werden das Verhältnis von Privathaushalt und städtischem Umfeld thematisiert, Einblicke in die urbane Lebensrealität im beschleunigten (Ess-)Alltag eröffnet und gesellschaftliche Wirkmechanismen freigelegt.
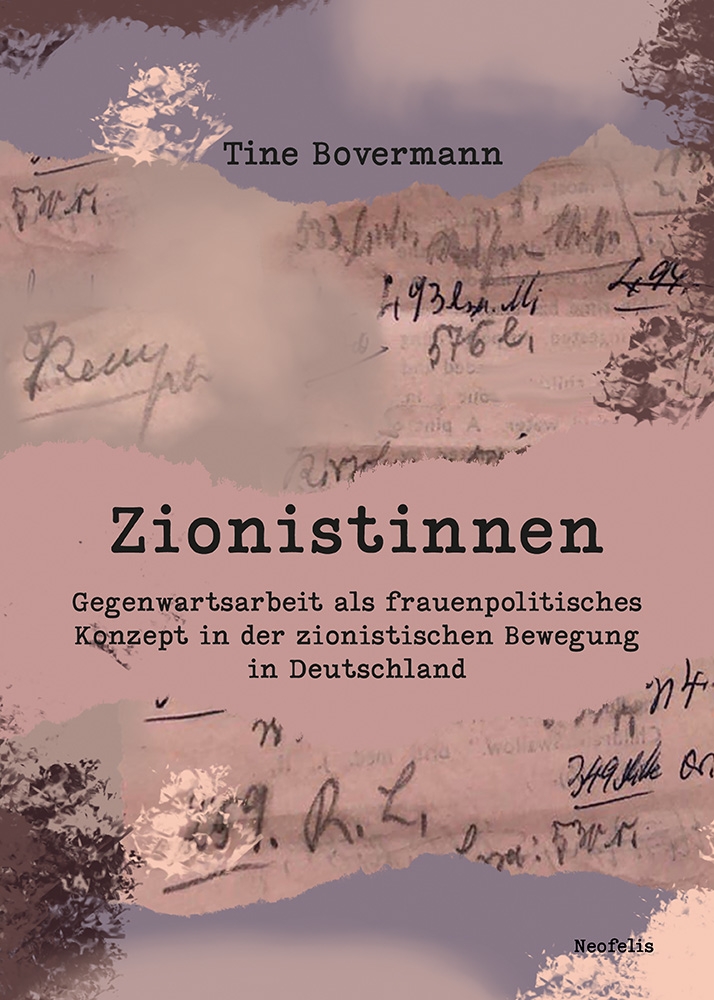
Zionistinnen
Gegenwartsarbeit als frauenpolitisches Konzept in der zionistischen Bewegung in Deutschland
Tine Bovermann, Neofelis Verlag, 2022, 328 Seiten, 29,00 €, ISBN: 978-3-95808-347-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Wie kann eine allgemeine Geschichte des Zionismus geschrieben werden, bei der Frauen im Zentrum der Betrachtung stehen? Ausgangspunkt der Studie ist ,Gegenwartsarbeit' als kulturelle und soziale Arbeit in der Diaspora. Diese sah bestimmte Rollen für Frauen vor und sicherte ihnen im zionistischen Entwurf der Nation eine tragende Funktion zu. Durch Gegenwartsarbeit waren Frauen aber nicht nur Teil der kulturzionistischen Strömung, sie nutzen sie auch zur Emanzipation. Zionistinnen entwickelten eine positive, spezifisch weibliche Identität, mit der sie ihre Interessen vertraten.
Die Studie zeigt, wie diese weibliche Identität im Zionismus über die Jahre immer wieder neu verhandelt wurde. Wesentlich war dabei ein nationales Selbstverständnis, das die Zionistinnen von der Gruppenidentität der Bewegung übernahmen. Sie identifizierten sich mit der Gemeinschaft aller Jüdinnen und Juden und handelten in ihrem Sinne. Die Gemeinschaft existierte für sie in ideeller und praktischer Form: Ideell war Zionismus eine kraft- und bedeutungsvolle Gemeinschaft politisch handlungsfähiger Personen, praktisch war Zionismus eine gemeinschaftsbildende Aktivität politisch Interessierter. In der Zusammenführung beider Ebenen lag die emanzipatorische Bedeutung der Gegenwartsarbeit für die Zionistinnen.
Tine Bovermann untersucht verschiedene Debatten zu frauenpolitischen Positionierungen innerhalb der zionistischen Bewegung in Deutschland zwischen 1900 und 1920 und macht sie durch die Einordnung in zeitgenössische Diskurse verständlich. Damit widerlegt ihr Buch die bisher angenommene ,Stummheit der Frauen' im deutschen Zionismus. Es zeigt auf, dass Frauen viel häufiger Stellung zu den allgemeinen, oftmals von Männern dominierten Themen der Bewegung bezogen haben als bisher angenommen. Die Studie erweitert die zionistische Geschichtsschreibung durch eine feministische Perspektive, indem sie Frauen als politisch handelnde Akteurinnen ernstnimmt - mit dem Wissen um die Reproduktion historischer Vorurteile, mit einem kritischen Blick auf Metanarrative und mit viel Empathie für den Gegenstand.
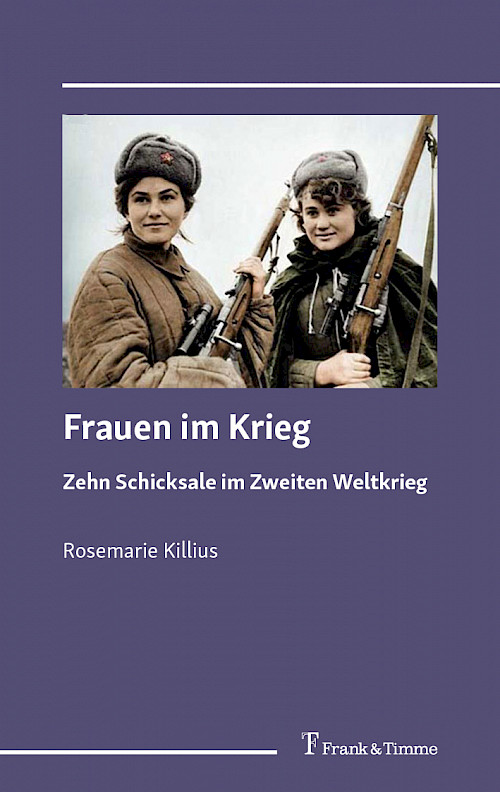
Frauen im Krieg
Zehn Schicksale im Zweiten Weltkrieg
Rosemarie Killius, Frank & Timme Verlag, 242 Seiten, 2022, ISBN 978-3-7329-0878-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Unser Bild vom Krieg ist männlich besetzt. In anderen Ländern war und ist das anders. So kämpften Frauen in der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg auch an der Front. Die Historikerin Rosemarie Killius lässt Frauen aus Russland, Frankreich und Deutschland berichten: So verschieden wie die soziale und geografische Herkunft, so unterschiedlich sind die Zusammenhänge, in denen sie den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Neben der sowjetischen Scharfschützin kommen Wehrmachtsangestellte zu Wort. Die Erinnerungen einer Frau aus der französischen Résistance und zweier Schwestern von Hitler-Attentätern stehen neben jenen einer russischen Zwangsarbeiterin und jenen jüdischer Frauen. Nicht weniger eindrucksvoll sind die Zeugnisse einer US-amerikanischen Übersetzerin und einer russischen Simultandolmetscherin beim Internationalen Militärtribunal in Nürnberg, die den Band beschließen.
Dr. Rosemarie Killius hat u. a. in Madrid und Paris Geschichte sowie französische und spanische Philologie studiert und in Biografieforschung promoviert. Sie publiziert zur Zeit des Nationalsozialismus und der Weltkriege. Ihr Engagement in Russland wurde mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Als Expertin für die Filmgeschichte der 1930er bis 1950er Jahre ist sie freie Mitarbeiterin bei der Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung und am Deutschen Filminstitut/ Filmmuseum (DFF).
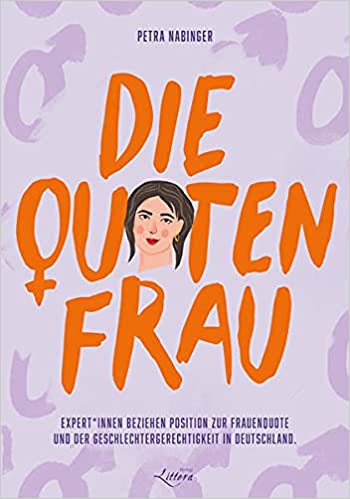
Die Quotenfrau – Expert*innen beziehen Position zur Frauenquote und der Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland
Petra Nabinger, LITTERA-Verlag, 2021, 300 Seiten, 24,90€, ISBN: 978-3-945734-48-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Ist die Frauenquote wirklich erforderlich? Persönlichkeiten, die in unserer Gesellschaft wichtige Funktionen innehaben, über Autorität und Entscheidungskompetenzen verfügen und eine gestaltende Rolle wahrnehmen, beziehen hier Position. Sie nehmen Stellung zur Frauenquote und der Geschlechtergerechtigkeit in Deutschland. Sie sprechen Empfehlungen aus, um die Machtverhältnisse zwischen Entscheiderinnen und Entscheidern in Unternehmen, Wissenschaft und Politik künftig ausgewogener zu gestalten. Denn es ist geboten, u.a. aus Gründen der Risikominimierung und der Wirtschaftlichkeit, mit mehr Nachdruck auf eine Balance über alle Hierarchieebenen hinweg hinzuwirken. Wie wichtig der Blick auf die Untenehmenskultur ist, darauf geht die Psychologin Martina Lackner ein. Die in den Organisationen und Unternehmen vorherrschende Führungskultur hat maßgeblich Einfluss darauf, ob Frauen in signifikanter Zahl in Führungspositionen gelangen. Lackner spricht hier von ´verborgenen Karrierewiderständen´. In ihrem Beitrag erklärt sie, was sich dahinter verbirgt und ob die Quote wirklich erforderlich ist. Entdecken sie den roten Faden, der sich durch alle Beiträge hindurchzieht. Er ist der Schlüssel zum Erfolg! Somit kann dieses Buch als Umsetzungs-Tool genutzt werden, um das UN-Nachhaltigkeitsziel ´Geschlechtergleichstellung´ in greifbare Nähe zu rücken. UN Women Deutschland setzt mit dem Vorwort der Vorsitzenden Elke Ferner und dem Schluss-Plädoyer der beiden HeForShe-Botschafter Martin Speer und Vincent-Immanuel Herr den geeigneten Rahmen. Auch Monika Schulz-Strelow, Präsidentin und Gründungsmitglied von FidAR, findet deutliche Worte.

Die Illusion der Leistungsgerechtigkeit
Arbeit und Entgelt von Sekretärinnen
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Jede erfolgreiche Führungskraft verfügt über ein leistungsstarkes »Vorzimmer«. Sekretärinnen an der Hochschule bilden etwa einen Berufsstand, mit dem Wissenschaftler_innen täglich kooperieren, ohne dass dieser je ernsthaft zum Gegenstand ihrer Forschung geworden wäre. Während Sekretariatsarbeit im öffentlichen Dienst durch technische und organisatorische Veränderungen zunehmend anspruchsvoller wird, bleibt die für frauentypische Assistenztätigkeiten übliche niedrige tarifliche Eingruppierung erhalten. Die Studie untersucht die daraus resultierende, individualisierte Form des Arbeitskonflikts um Entgelt. Organisationale Arbeitsplatzbewertungen werden zum Austragungsort der Lohnfindung, in denen Vorstelllungen von Leistung und Gerechtigkeit aufeinandertreffen und unter Bezugnahme auf das Leistungsprinzip ausgehandelt werden.
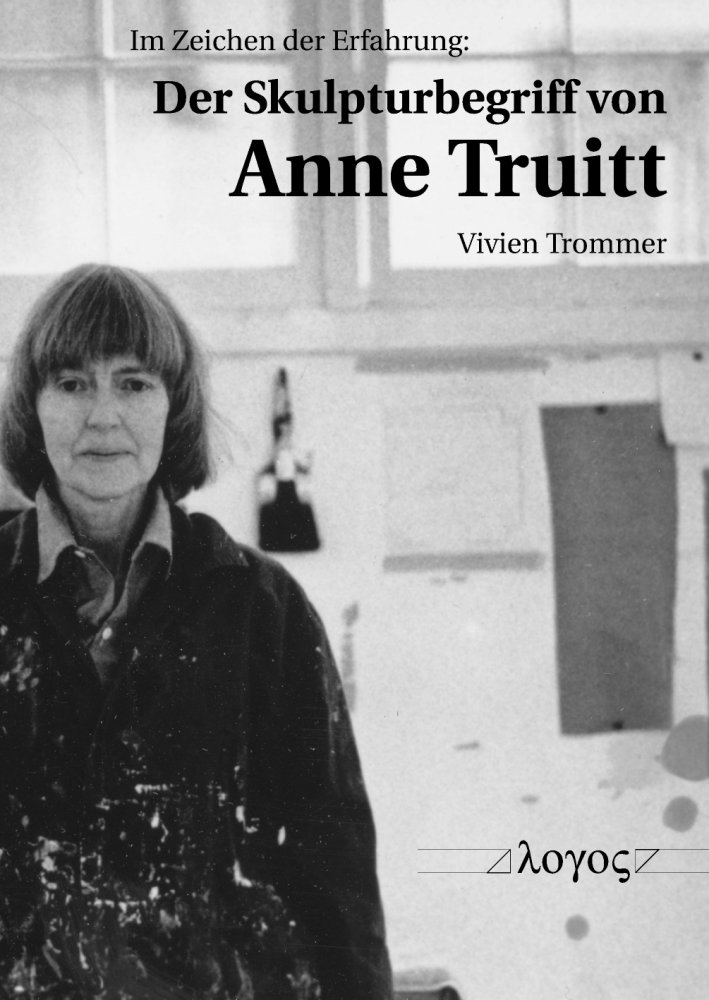
Im Zeichen der Erfahrung
Der Skulpturbegriff von Anne Truitt
Vivien Trommer, Logos Verlag Berlin, 2021, 273 Seiten, 59,00 €, ISBN 978-3-8325-5248-0
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Das Œuvre der US-amerikanischen Künstlerin Anne Truitt (1921-2004) wird seit den frühen 1960er Jahren von der Forschung rezipiert. Zugleich ist ihr idiosynkratischer Skulpturbegriff diesseits hegemonialer Lesarten der Minimal Art und des Color Field Painting bis heute glq randständiggrq geblieben. Die werkmonographische Studie von Vivien Trommer widmet sich gattungs- und wahrnehmungstheoretischen Fragestellungen und untersucht Anne Truitts künstlerische Neuerungen im Kontext der Geschichte der Skulptur des 20. Jahrhunderts. Gefragt wird nach den Bezügen ihrer Werke zum Paragonestreit, zur Sockelfrage, zur Immanenzebene der Oberfläche und zu ihren künstlerischen Ausstellungsinszenierungen im modernen Galerieraum. Dabei zeigt sich, dass Anne Truitts Skulpturen - mit ihren Entgrenzungstendenzen und Reflexionsmomenten - ganz im Zeichen einer betrachterorientierten Erfahrungsästhetik stehen.
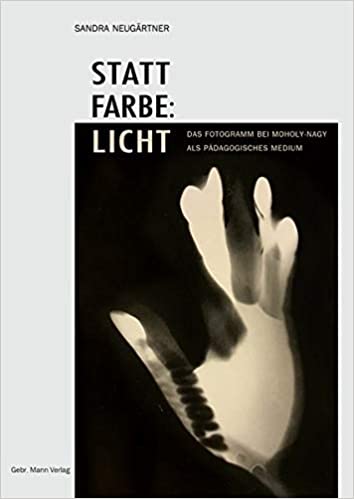
Statt Farbe: Licht
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
László MoholyNagy (1895–1946) erkannte und aktivierte erstmals das pädagogische Potenzial des Fotogramms. Vorgelegt wird die erste Untersuchung seiner FotogrammPädagogik und ihrer kunsthistorischen Bedeutung. Als Ergebnis seiner Bemühungen, Malerei als eine Kunst zu verstehen, die nicht aus Pigmenten, sondern aus Licht besteht, entwickelte MoholyNagy das Fotogramm zu einer neuen Hauptform der AvantgardePraxis. Beim Übergang der optischen Künste zu den optischen Medien nimmt das Fotogramm eine Sonderstellung ein: Es kontrastiert als rein indexikalisches Medium alle kamerabasierte Fotografie, die einen mimetischen Effekt forciert und den Übergang in die Sprache vollzieht.

Künstliche Intelligenz im politischen Diskurs
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Als Schlüsseltechnologie der digitalen Transformation ist die Künstliche Intelligenz Teil unseres Alltags geworden. Die KI-bedingten Auswirkungen auf die Lebens- und Arbeitswelt haben eine hohe gesellschaftliche Relevanz und müssen daher auf politischer Ebene behandelt werden. Diese Forschungsarbeit unterzieht den Diskurs um die KI im Deutschen Bundestag – als zentraler Ort der Auseinandersetzung im demokratischen System – von der ersten Nennung des Begriffs im Jahr 1984 bis zur Einsetzung der Enquete-Kommission im Juni 2018 einer Kritischen Diskursanalyse. Das Jahr 2016 stellt sich dabei als Wendepunkt im parlamentarischen Diskurs heraus, der den politischen Umgang mit den immensen Potenzialen und Risiken dieser Technologie verhandelt.
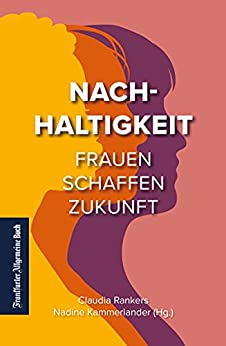
Nachhaltigkeit – Frauen schaffen Zukunft
Nadine Kammerlander, Claudia Rankers, Frankfurter Allgemeine Buch, 2021, 288 seiten, 23,00€, ISBN: 978-3-96251-115-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
"Was wir heute tun, entscheidet darüber, wie die Welt morgen aussieht."
Besser als Marie Freifrau von Ebner-Eschenbach kann man unsere aktuelle Situation und die anstehenden Herausforderungen nicht auf den Punkt bringen. Wir stehen in Deutschland vor vielen Umbrüchen durch Globalisierung, Digitalisierung und den demografischen Wandel. Bei allen Strategien und Maßnahmen müssen wir zeitgleich jedoch auch die Nachhaltigkeit beachten, denn Nachhaltigkeit ist eine überlebenswichtige Aufgabe, der sich Unternehmen und Gesellschaft stellen müssen.
Aber wie kann dieser Herausforderung aus ökologischer und sozialer Sicht begegnet werden?
Der Landesfrauenrat Rheinland-Pfalz ist überzeugt, dass Innovation ein Schlüssel dazu ist. In diesem Buch haben die Herausgeberinnen Claudia Rankers und Prof. Dr. Nadine Kammerlander bedeutende Frauen in Führungspositionen dazu eingeladen, ihre Maßnahmen für eine nachhaltige Unternehmenspraxis zu skizzieren. Im Mittelstand, in Verbänden, Stiftungen und der Wissenschaft setzen sie sich täglich dafür ein, eine nachhaltige Zukunft zu gestalten, und schaffen Arbeitsräume, die eine Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen; sie zahlen anständige Löhne und binden Mitarbeitende in wesentliche Entscheidungen ein; sie setzen auf Innovationen, Ressourcenreduzierung und Erneuerbare Energien. So haben sie einen positiven Impact auf die 17 UN-Nachhaltigkeitsziele, die SDGs (Sustainable Development Goals), und berücksichtigen dabei die ESG-Qualitätskriterien der Unternehmensführung, die für Environment, Social und Governance stehen.
Es geht um weitaus mehr als um einen Trend, denn
•Unternehmen richten sich zunehmend auf ESG und SDGs aus,
•auch in der Finanzindustrie sind ESG und SDGs Tagesthemen,
•Nachhaltigkeit ist ein Zukunftsthema.
Entstanden ist ein Sachbuch mit einer Fülle von eindrucksvollen Best Practices, das informiert, inspiriert und zum Weiterdenken motiviert. Dabei wird vor allem eines deutlich: Nur wenn wir weiterhin innovativ denken, werden wir Lösungen für die vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit finden.
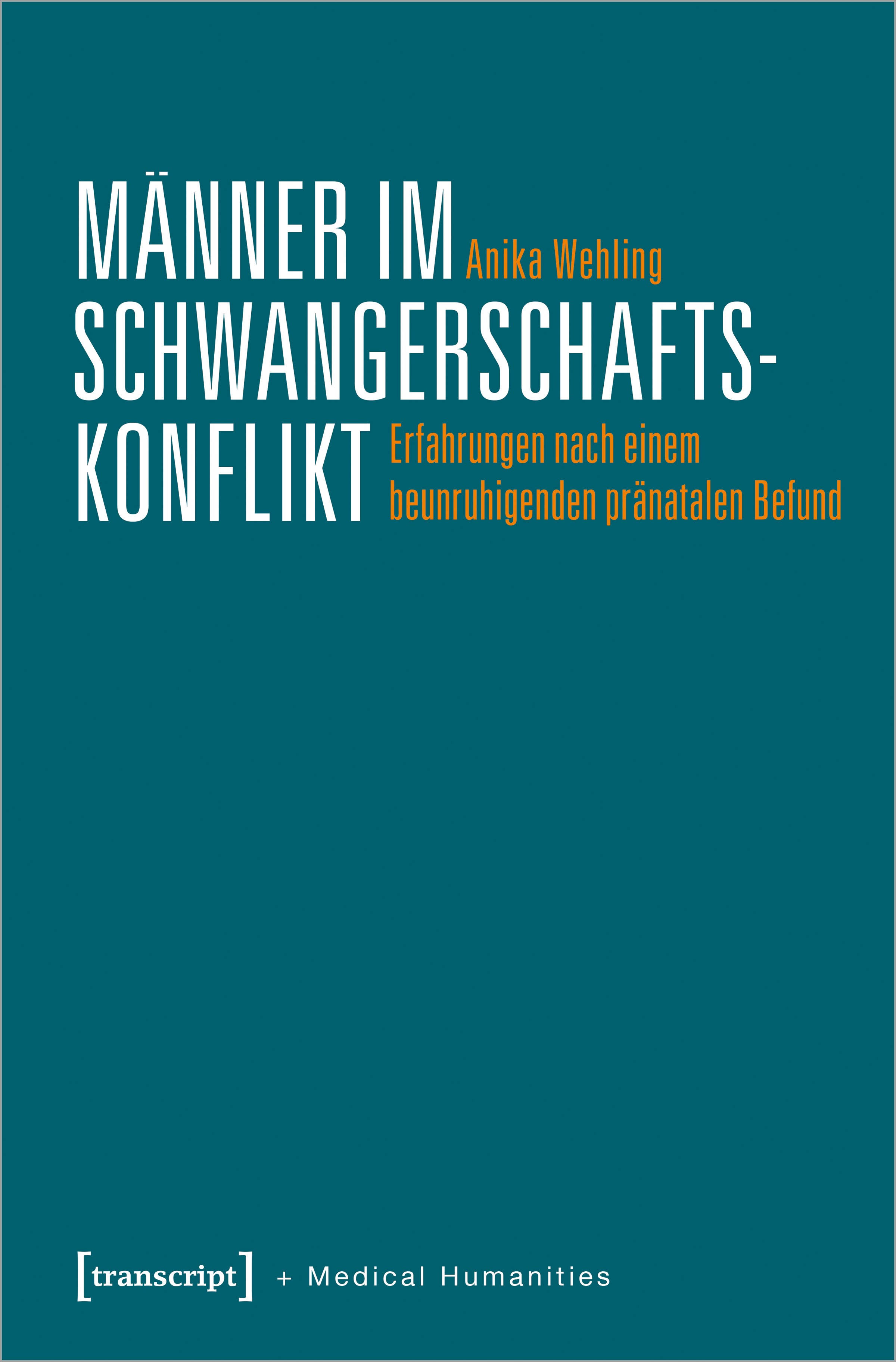
Männer im Schwangerschaftskonflikt
Erfahrungen nach einem beunruhigenden pränatalen Befund
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Kenntnis über eine Behinderung des Ungeborenen wird von betroffenen Eltern oft als schockierend erlebt. Neben der Schwangeren sind auch werdende Väter von einem Befund emotional betroffen. Entsprechende Aufmerksamkeit wird Männern in dieser Situation aber kaum zuteil. »Kann und möchte ich Vater eines behinderten Kindes sein? Welche Entscheidung wird meine Partnerin treffen? Was heißt es für uns als Paar, mit einem behinderten Kind zu leben?« – Im Spannungsverhältnis zwischen der eigenen Belastung und einer erlebten Verantwortung berichten Männer von ihren Erfahrungen, Konflikten und deren Bewältigung.
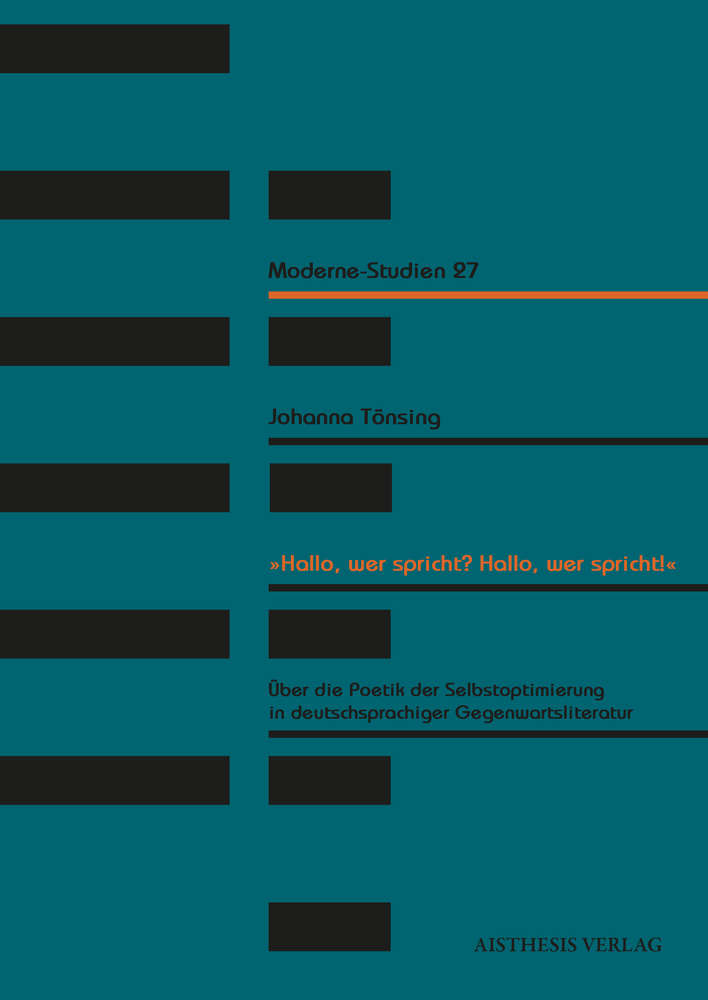
"Hallo, wer spricht? Hallo, wer spricht!"
Über die Poetik der Selbstoptimierung in deutschsprachiger Gegenwartsliteratur
Johanna Tönsing, Aisthesis Verlag, 2021, Moderne-Studien Band 27, 342 Seiten, 39,00 €, ISBN: 978-3-8498-1767-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die in der soziologischen Fachliteratur überwiegende These von der neoliberalen Determinierung zeitgenössischer Subjekte deckt sich größtenteils mit der Darstellung der Subjektivierungsweise in der Literatur, aber eben nicht ausschließlich. Denn literarische Texte zeigen Facetten der Subjektivierungsfigur, die so kaum oder nicht in außerliterarischen Wissensbereichen aufzufinden sind. Und einige Texte ordnen ›Selbstoptimierung‹ mitunter auch in Abgrenzung zu den so populären Gouvernementalitätsstudien ein. Damit eröffnet sich folgendes Forschungsdesiderat: während andere Wissensbereiche das Aufkommen der Subjektivierungsfigur bereits analysiert haben, fehlt eine Untersuchung darüber, welches Wissen die Literatur über »Selbstoptimierung« gespeichert hat.
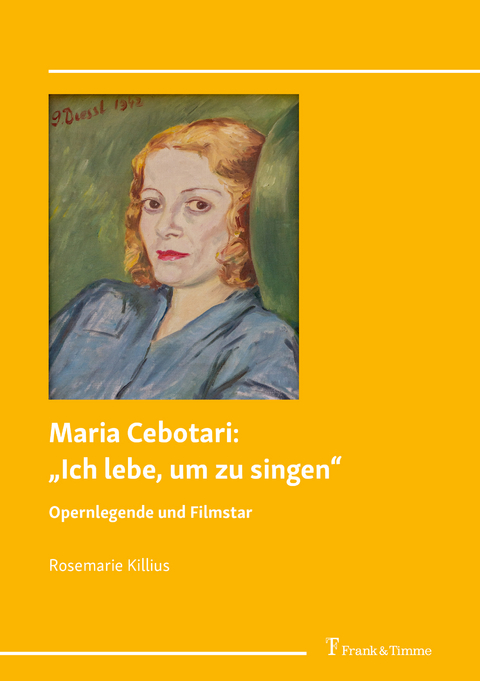
Maria Cebotari: „Ich lebe, um zu singen“
Opernlegende und Filmstar
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Opernsängerin und Filmschauspielerin Maria Cebotari (* 1910 in Chișinău, † 1949 in Wien) gilt als eine der bedeutendsten Sopranistinnen des 20. Jahrhunderts. Rosemarie Killius’ akribisch recherchierte Biografie porträtiert die hochtalentierte Primadonna und außergewöhnlich begabte Schauspielerin.
Cebotaris Lebensweg ist gezeichnet von Ehrgeiz, Fleiß und Ausdauer, ihre Kunst geprägt von seltener Harmonie, Präzision und Grazie. Rosemarie Killius macht deutlich, welchen Einfluss Herkunft, Sprache und Familie auf den Werdegang der Künstlerin hatten. Dabei stellt sie stets die Person Maria Cebotari in den Mittelpunkt und korrigiert allerlei bislang falsch überlieferte Fakten. Briefe der Sängerin und ihres zweiten Ehemanns, Schauspieler und Grafiker Gustav Diessl, gewähren persönliche Einblicke in ihr Leben zwischen Familie und Bühne. Zeitgenössische Tagebuchaufzeichnungen der Wiener Schauspielschülerin Elfriede N. machen die Begeisterung des Publikums greifbar. Zahlreiche Fotografien und Abbildungen ergänzen den Band.
Zur Autorin: Dr. Rosemarie Killius hat u. a. in Madrid und Paris Geschichte sowie französische und spanische Philologie studiert und in Biografieforschung promoviert. Sie publiziert zur Zeit des Nationalsozialismus und der Weltkriege. Ihr Engagement in Russland wurde mit dem Bundesverdienstkreuz gewürdigt. Als Expertin für die Filmgeschichte der 1930er bis 1950er Jahre ist sie freie Mitarbeiterin am Deutschen Filminstitut/Filmmuseum (DFF), organisiert Vorträge und Seminare sowie Hommagen an große Film- und Bühnenkünstler.
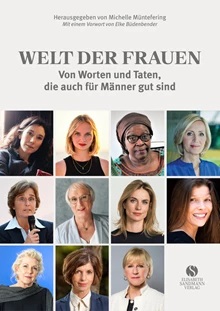
Welt der Frauen
Von Worten und Taten, die für uns alle gut sind
Michelle Müntefering (Hrsg.). Mit einem Vorwort von Elke Büdenbender. München, 2021. 159 Seiten, 25,00 €, ISBN 978-3-945543-93-1.
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Gleichstellung: eine Frage politischer Prioritäten.
Frauen aus Kunst, Kultur, Politik, Wissenschaft, Sport und Zivilgesellschaft erzählen in persönlichen Texten von den besonderen Erlebnissen und Begegnungen, die ihr Leben und ihre Arbeit verändert haben. Das Buch bildet ein eindrucksvolles Mosaik starker Frauen, die mit ihrem Engagement Grenzen überwinden und in einer globalisierten Welt Verantwortung übernehmen - von der Reporterin, die über die Folgen von Krieg und Gewalt für Mädchen und Frauen berichtet, bis zur Schauspielerin, die ein Frauenhaus in Brasilien mitbegründet. Es sind Frauen, die sich nicht einschüchtern lassen, die immer wieder unbequeme Themen ansprechen und auf Missstände aufmerksam machen. Es sind Frauen, für die Gleichberechtigung kein utopischer Wunsch ist, sondern ein Ziel, für das es sich zu kämpfen lohnt. Hier erzählen sie von sich: von ihren Zielen, ihrer Motivation, von ihrer ganz persönlichen Lebensgeschichte bis hin zu ihrer Arbeit an den Schaltstellen der großen Weltpolitik in den Vereinten Nationen.

Mist, die versteht mich ja
Aus dem Leben einer Schwarzen Deutschen
Florence Brokowski-Shekete, Orlanda Verlag GmbH, 2021, 250 Seiten, 22,00 €, ISBN: 978-3-944666-76-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die kleine Florence, geboren in Hamburg als Kind nigerianischer Eltern, wird Ende der 60er-Jahre in Buxtehude von einer alleinstehenden Frau in Pflege genommen. Mit acht Jahren nehmen die Eltern sie mit nach Lagos, in ein Land, dessen Sprache sie nicht spricht, dessen Kultur ihr fremd ist, zu einer Familie, die sie nicht kennt. Durch das beherzte Eingreifen einer Lehrerin schafft sie es zurück nach Deutschland und macht dort ihren Weg ...
In ihrer Autobiografie beschreibt die Autorin mit einer guten Prise Humor die Erlebnisse einer Schwarzen Frau in einer weißen Gesellschaft, den schmalen Grat zwischen witzigen Anekdoten und unschönem Alltagsrassismus, zwischen der Herausforderung, Brücken zu bauen, und Grenzen zu setzen, zwischen Integration und Identitätsfindung, zwischen Beruf und dem Muttersein als Alleinerziehende – kurz: die Lebensgeschichte einer beeindruckenden Frau.
Florence Brokowski-Shekete ist Schulamtsdirektorin in Baden-Württemberg, als erste Schwarze in Deutschland. Sie ist Gründerin der Agentur FBS intercultural communication, bei der sie seit 1997 als freie Beraterin, Coach und Trainerin tätig ist. Sie arbeitete als Lehrerin, Schulleiterin und Schulrätin. Und sie mischt sich ein und setzt Grenzen, wenn sie auf Alltagsrassismus stößt.

Diversität in Kulturinstitutionen 2018-2020
Initiative Kulturelle Integration
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Diversität in Kultureinrichtungen ist ein zentrales Thema. In diesem Band werden die Ergebnisse einer erstmaligen Befragung von bundesgeförderten Kultureinrichtungen und -institutionen zur Diversität in ihren Einrichtungen vorgestellt. Es geht darum, wie viele Frauen und Männer in den Einrichtungen arbeiten, wie die Altersstruktur der Beschäftigten aussieht, wie hoch der Anteil der Beschäftigten mit Migrationshintergrund ist und wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit einer Behinderung beschäftigt werden.
Weiter wird untersucht, wie divers das Publikum und das Programm sind. In abschließenden Handlungsempfehlungen wird aufgezeigt, was die Einrichtungen und was die Kulturpolitik leisten kann, um mehr Diversität zu ermöglichen.
Das Buch können Sie auch als PDF herunterladen: www.kulturrat.de/publikationen/diversitaet-in-kulturinstitutionen-2018-2020/

Kunsthistorikerinnen 1910 - 1980
Theorien, Methoden, Kritiken
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die „Altmeister der Kunstgeschichte" und ihre Werke sind fester Bestandteil des universitären Studiums. Der Beitrag früher Kunsthistorikerinnen zur Entwicklung der Disziplin ist hingegen bis heute weitgehend unsichtbar. Welche neuen Sichtweisen auf die Kunst, welche Methoden und Fragestellungen entwickelten die ersten Kunsthistorikerinnen, die seit dem späten 19. Jahrhundert im deutschsprachigen Raum zum Studium zugelassen wurden? Welche Wirkungsfelder erschlossen sie sich, bevor der Nationalsozialismus vielen von ihnen eine Zäsur setzte, die nach 1945 nur langsam überwunden werden konnte?
In dem Band werden 24 Texte vorgestellt, die zwischen 1910 bis 1980 entstanden sind. Expert*innen führen in die Entstehungszusammenhänge der Texte ein. So macht der Band Arbeiten früher Kunsthistorikerinnen wieder zugänglich und lädt dazu ein, die Vielfalt der Disziplin neu zu entdecken.
Die Herausgeberinnen
K. Lee Chichester ist Kunsthistorikerin und freie Kuratorin in Berlin mit Schwerpunkt Kunst und Wissenschaft der Frühen Neuzeit sowie des 19./20. Jahrhunderts. Brigitte Sölch ist Professorin für Architektur und Designgeschichte/Architekturtheorie an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart mit Schwerpunkt auf politischer Ideengeschichte sowie Architektur und Problemgeschichte des Öffentlichen aus historisch und kulturell vergleichenden Perspektiven.
Die Autor*innen
Leonie Beiersdorf, Karlsruhe; Irene Below, Werther; Gerda Breuer, Aachen; Matthias Bruhn, Karlsruhe; K. Lee Chichester, Berlin; Brenda Danilowitz, Bethany/CT; Burcu Dogramaci, München; Nikola Doll, Bern; Annette Dorgerloh, Berlin; Mechthild Fend, London; Beate Fricke, Bern; Joachim Gierlichs, Berlin; Laura Goldenbaum, Berlin; Christine Göttler, Bern; Anna Grasskamp, Hongkong; Henrike Haug, Köln; Godehard Janzing, Marburg; Luise Mahler, New York; Barbara Paul, Oldenburg; Brigitte Sölch, Stuttgart; Miriam Szwast, Köln; Stefan Trinks, Frankfurt a. M.; Jo Ziebritzki, Heidelberg.
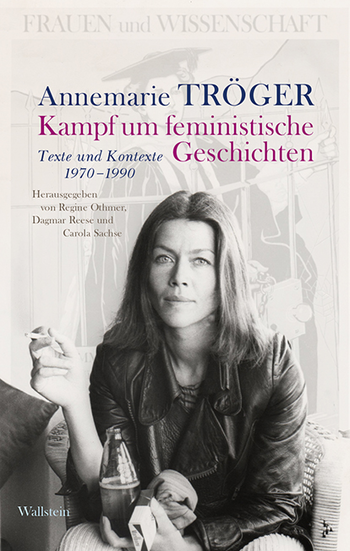
Annemarie Tröger Kampf um feministische Geschichten
Texte und Kontexte 1970-1990
39,00 €, ISBN 978-3-8353-3788-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Annemarie Tröger gehörte in den 1970er Jahren zu den Begründerinnen der Frauenforschung im deutschsprachigen Raum. Mit ihrer feministischen Radikalität, die ein anti-disziplinäres Erkenntnisinteresse antrieb, war sie für viele Studentinnen und Kolleginnen wegweisend. Die Pionierin der Methode der Oral History wollte die Erfahrungen marginalisierter sozialer Gruppen in die Geschichte einschreiben und sie zugleich für eine Analyse gegenwärtiger Zustände nutzen und im Kampf gegen anhaltende Herrschaftsverhältnisse mobilisieren. Die Disziplinierung der Frauenforschung seit den 1980er Jahren verdrängte Intellektuelle wie Tröger und führte dazu, dass wichtige Impulse der frühen Frauenforschung heute in Vergessenheit geraten sind.
In diesem Band werden ausgewählte Schriften Annemarie Trögers neu zugänglich gemacht und in Kommentaren ehemaliger Weggefährtinnen und Weggefährten als historische Quellen behandelt, die ein Stück bundesrepublikanischer, vor allem Westberliner Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte, wieder freilegen.
Annemarie Tröger (1939-2013) gehörte zur Gruppe der Initiatorinnen der ersten Berliner Sommeruniversitäten von 1976 und 1977, die ein Startschuss waren für die Entwicklung der bundesdeutschen Frauenforschung. Sie setzte sich früh mit dem Thema »Frauen und Nationalsozialismus« auseinander und war zugleich eine Pionierin der Oral History.
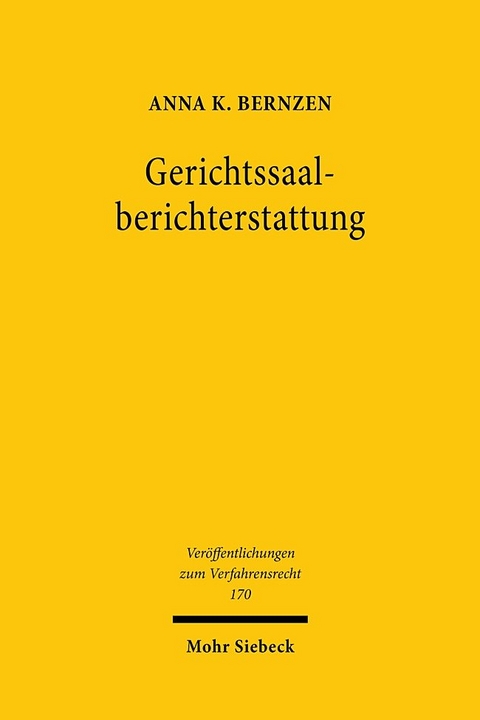
Gerichtssaalberichterstattung
Ein zeitgemäßer Rahmen für die Arbeit der Medienvertreter in deutschen Gerichten
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Der Öffentlichkeitsgrundsatz erlaubt nicht nur "gewöhnlichen" Bürgern, sondern auch Medienvertretern, den Verhandlungen deutscher Gerichte beizuwohnen. Der Medienberichterstattung aus dem Gerichtssaal werden durch das Gesetz und die Gerichte allerdings enge Grenzen gesetzt, die seit den 1960er Jahren weitgehend unverändert sind. Seitdem haben sich die Medienbranche und der Medienkonsum jedoch grundlegend gewandelt. Anna K. Bernzen widmet sich daher der Frage, ob und inwiefern der aktuelle Rechtsrahmen für Medienberichte aus dem Gerichtssaal noch zeitgemäß ist. Sie analysiert die schutzwürdigen Interessen, die bei der Berichterstattung kollidieren, und unternimmt eine vergleichende Betrachtung der englischen Rechtslage. Sie kommt zu dem Schluss, dass Reformbedarf besteht. Deshalb entwickelt die Autorin einen Gesetzesvorschlag, der eine zeitgemäße Berichterstattung ermöglichen soll. Der Öffentlichkeitsgrundsatz erlaubt nicht nur "gewöhnlichen" Bürgern, sondern auch Medienvertretern, den Verhandlungen deutscher Gerichte beizuwohnen. Der Medienberichterstattung aus dem Gerichtssaal werden durch das Gesetz und die Gerichte allerdings enge Grenzen gesetzt, die seit den 1960er Jahren weitgehend unverändert sind. Seitdem haben sich die Medienbranche und der Medienkonsum jedoch grundlegend gewandelt. Anna K. Bernzen widmet sich daher der Frage, ob und inwiefern der aktuelle Rechtsrahmen für Medienberichte aus dem Gerichtssaal noch zeitgemäß ist. Sie analysiert die schutzwürdigen Interessen, die bei der Berichterstattung kollidieren, und unternimmt eine vergleichende Betrachtung der englischen Rechtslage. Sie kommt zu dem Schluss, dass Reformbedarf besteht. Deshalb entwickelt die Autorin einen Gesetzesvorschlag, der eine zeitgemäße Berichterstattung ermöglichen soll.
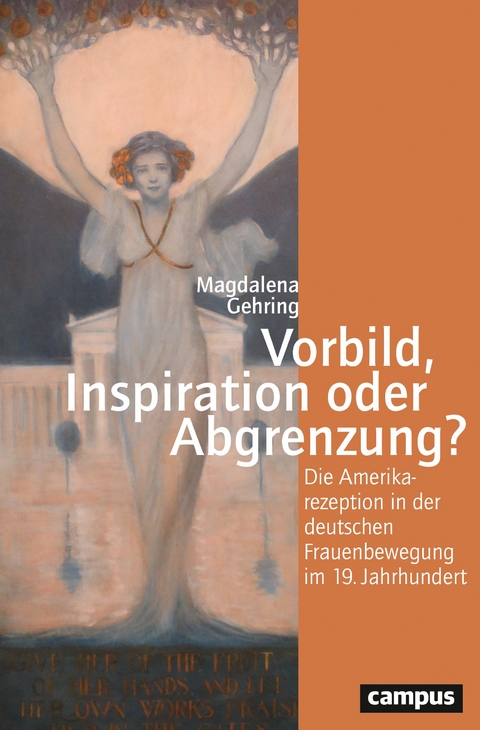
Vorbild, Inspiration oder Abgrenzung?
Die Amerikarezeption in der deutschen Frauenbewegung im 19. Jahrhundert
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Bereits im 19. Jahrhundert pflegten die Frauenbewegungen in Europa und den USA sowohl persönliche als auch institutionalisierte Kontakte und initiierten regelmäßig Kongresse. Magdalena Gehring zeichnet die Entstehung dieser international agierenden Frauenbewegung und die Partizipation deutscher Akteurinnen daran nach. Daneben untersucht sie, welchen programmatischen Einfluss die kontinuierliche Rezeption der US-amerikanischen Frauenbewegung auf die deutsche Frauenbewegung, insbesondere auf den Allgemeinen Deutschen Frauenverein, ausübte. Im Fokus stehen dabei Fragen nach der Funktion, dem Ablauf und der Zielsetzung dieser Rezeptions- und Transferprozesse.
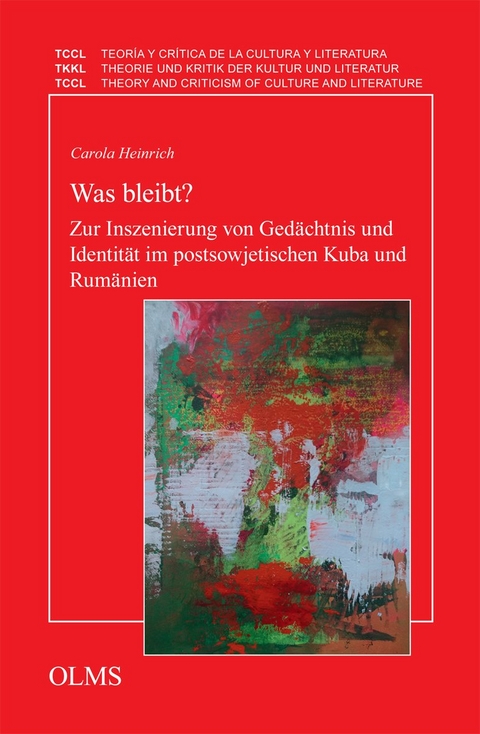
Was bleibt? Zur Inszenierung von Gedächtnis und Identität im postsowjetischen Kuba und Rumänien
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Publikation beschäftigt sich aus postkolonialer Perspektive mit den Nachwirkungen der sowjetischen Dominanz auf zwei zuvor stark unter sowjetischem Einfluss stehende Kulturen: Kuba und Rumänien. Untersucht wird die Reaktion auf den Wegfall der Hegemonialmacht Sowjetunion anhand ihrer Inszenierung in Theater, Performance, Film, Video und Hörspiel seit 1989. Die vergleichende Recherche analysiert die Machtstrukturen in performativen Werken ausgehend von Theorien der Translation, die den Wandel der Rolle, der Darstellung und der Attribuierung des kulturellen Fremdbildes ‚des Russen/der Russin‘ nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion beleuchten. Die Analyse der Translationsprozesse erfolgt auf zwei Ebenen: zeitlich durch die Konstruktion eines kulturellen Gedächtnisses, und räumlich durch Identifikation über Hybridisierung. Der Fokus liegt auf der Frage, wie es den Inszenierungen gelingt zur Konstruktion, Reflexion und Transformation kultureller Wahrnehmungsmuster beizutragen. Die Lösungen reichen dabei von einer Inversion der Machtverhältnisse durch subversiven Humor, über eine nostalgische Sehnsucht bis zu einer Resolidarisierung durch Migration.
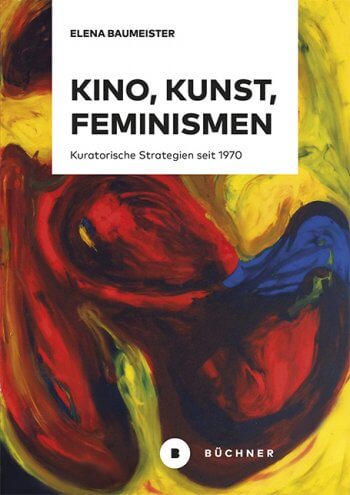
Kino, Kunst, Feminismen
Kuratorische Strategien seit 1970
Elena Baumeister, Büchner-Verlag, 2020, 126 Seiten, 22,00 € , ISBN: 978-3-96317-224-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Was bedeutet es, feministisch zu kuratieren? Sind Feminismen Inhalt oder Methode? An welchen Orten und in welcher Weise ist der feministische Diskurs in die Ausstellungspraxis sowie in die Filmkultur eingegangen bzw. aus ihr hervorgegangen? Im Spannungsfeld dieser Fragen skizziert Elena Baumeister anhand von Archivmaterial und einer Reihe von Gesprächen mit Kuratorinnen, wie sich feministische Strategien des Kuratierens von Kunstausstellungen und Filmprogrammen im deutschsprachigen Raum seit ihren Anfängen in den 1970er Jahren bis heute entfaltet haben. Sie spürt deren kritischen, subversiven und gestalterischen Potenzialen nach und leistet einen Beitrag, die Lücke in der Theoretisierung feministisch-kuratorischer Praxis zu füllen.
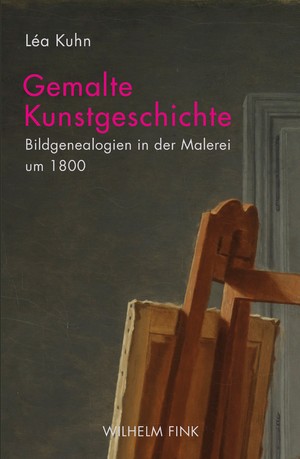
Gemalte Kunstgeschichte
Bildgenealogien in der Malerei um 1800
Léa Kuhn, Verlag Wilhelmm Fink, 333 Seiten, 69,00 €, ISBN: 978-3-7705-6453-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Kunstgeschichte wird nicht nur geschrieben, sie wird auch gemalt. Dass auch innerhalb der Malerei vermehrt kunsthistorische Ordnungsmodelle entwickelt werden, sobald sich die Kunstgeschichte als akademische Disziplin zu etablieren beginnt, zeigt diese Studie.
Mit Blick auf die Zeit um 1800 rekonstruiert die Autorin das feine Bezugsgeflecht zwischen entstehendem Kunstgeschichts-diskurs und zeitgenössischer künstlerischer Praxis an so unterschiedlichen Orten wie Zürich, Paris, London und New York. Dabei wird deutlich: Die hier analysierten Werke von Marie-Gabrielle Capet, William Dunlap und Johann Heinrich Wilhelm Tischbein illustrieren nicht bereits vorhandene kunst-historische Narrative, sondern bringen selbst Vorschläge zu ihrer adäquaten Einordnung hervor - und weisen andere zurück. Geschichtsschreibung ist folglich nicht der einzige epistemologische Zugang zu (Kunst-)Geschichte und nicht die einzige Möglichkeit zu deren aktiver Gestaltung: In der Malerei selbst gibt es ein analoges Phänomen, das hier für die Zeit um 1800 erstmals umfassend nachgezeichnet wird.
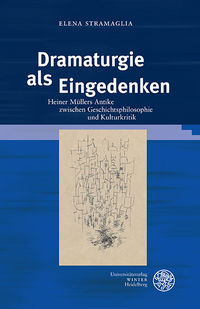
Dramaturgie als Eingedenken
Heiner Müllers Antike zwischen Geschichtsphilosophie und Kulturkritik
Elena Stramaglia, Universitätsverlag WINTER Heidelber, 2020, 229 Seiten., 42,00 €, ISBN: 978-3-8253-4716-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Heiner Müllers Antikedramen reflektieren nicht nur einen kritischen Umgang mit Aspekten der westlichen Literaturtradition, sondern einen umfassenderen Denkkomplex um Geschichte, Mythos und Kultur. Bei der Gestaltung dieses Horizonts spielt der philosophische Dialog mit Walter Benjamin, Max Horkheimer und Theodor W. Adorno eine entscheidende Rolle. Die Monographie untersucht, wie diese intertextuelle Reflexion sich mit der Praxis der Antikerezeption verbindet und wie sie in den Dramen in literarisch vielfältiger Methodik dargestellt und problematisiert wird. Neben den theoretischen Prämissen des Dialogs werden dessen Wirkungen in drei Stücken in Augenschein genommen: Philoktet, Ödipus Tyrann und Verkommenes Ufer Medeamaterial Landschaft mit Argonauten. Anhand der Texte werden die politisch-geschichtliche Tragweite von Müllers Arbeit an Mythos und Tragödie, deren geschichtsphilosophische Prägung sowie ihre kulturkritische Funktion analysiert.
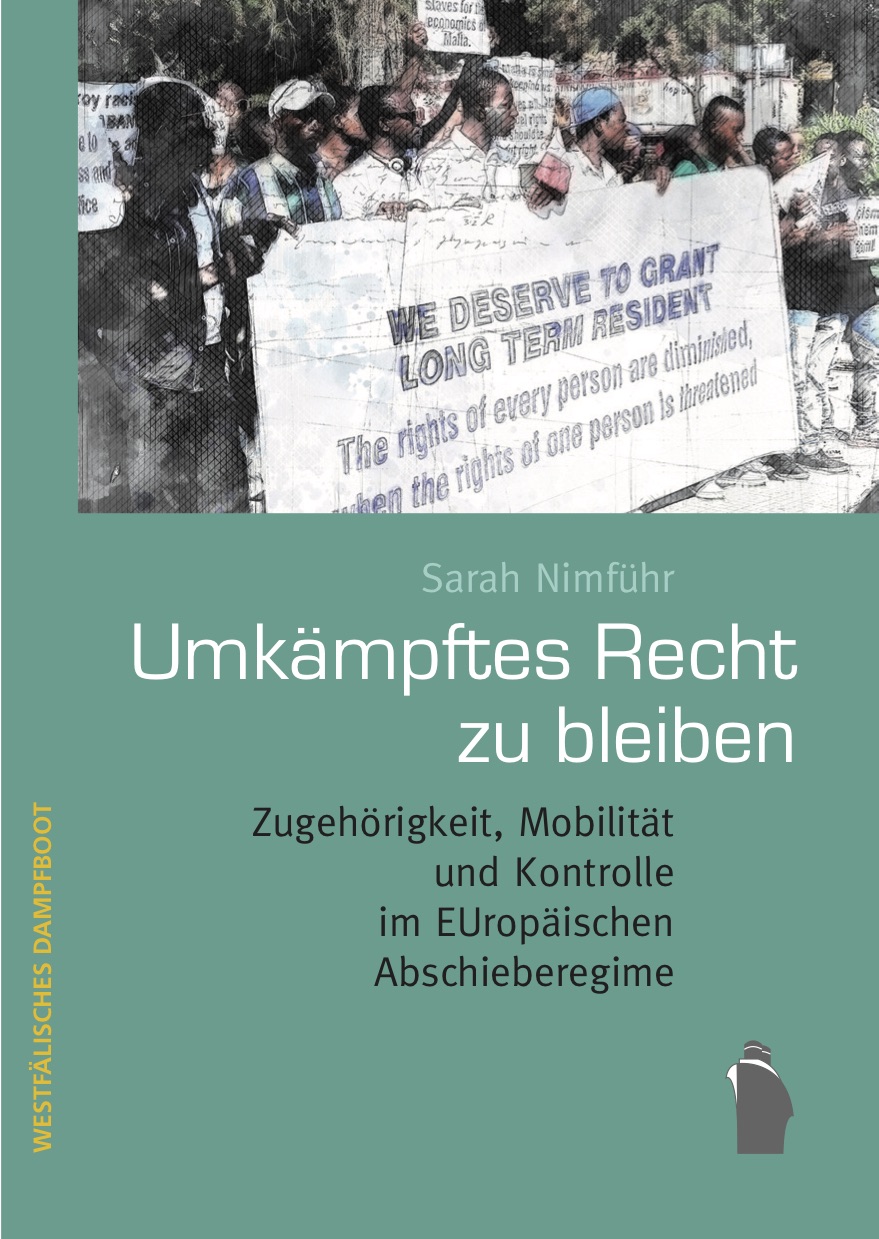
Umkämpftes Recht zu bleiben
Zugehörigkeit, Mobilität und Kontrolle im EUropäischen Abschieberegime
Sarah Nimführ, Westfälisches Dampfboot (Verlag) 2020, 375 Seiten, 38,00 €, ISBN: 978-3-89691-052-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Mehrheit abgelehnter Asylsuchender in Malta, der EU-Außengrenze, ist nicht abschiebbar. Viele befinden sich in einer rechtlichen Grauzone, da ihnen ein formaler Aufenthaltsstatus meist verwehrt bleibt. In dieser Situation haben sie über mehrere Jahre hinweg nur begrenzten Zugang zu Beschäftigung, grundlegenden Dienstleistungen und medizinischer Versorgung. In einer ethnografischen Untersuchung an der EU-Außengrenze Malta analysiert Sarah Nimführ Aushandlungsprozesse zwischen nicht abschiebbaren Geflüchteten, ihren Unterstützer*innen und staatlichen Akteur*innen. Sie zeigt, wie sich das Leben von Menschen mit einem nicht durchgeführten Ausweisungsbescheid gestaltet und welche Praktiken der Alltagsorganisation sie anwenden.
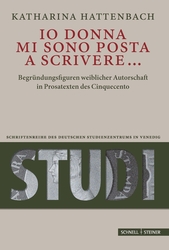
Io donna mi sono posta a scrivere...
Begründungsfiguren weiblicher Autorschaft in Prosatexten des Cinquecento
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Im 16. Jahrhundert kam es in Italien, vor allem in Venedig, zum ersten Mal zu einer ganzen Welle an Publikationen von Texten, die von Autorinnen geschrieben wurden. Die vorliegende Monografie geht der Frage nach, wie die Autorinnen ihr Schreiben und ihren Schritt an die Öffentlichkeit begründeten.

Wie uns Vielfalt bereichert
Zehn Frauenportraits
Petra Nabinger, Littera-Verlag, 181 Seiten, 12,90 €, ISBN 978-3-945734-47-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Portraitsammlung bietet einen facettenreichen Einblick in verschiedenste Kulturen. Im interkulturellen Dialog wird deutlich, wie bereichernd diese Fülle und Buntheit für uns alle sein kann. Die vorgestellten Frauen haben Vorbildfunktion, da es ihnen gelungen ist, ein Stück der Kultur ihres Herkunftslandes bzw. das ihrer Eltern zu erhalten und zu bewahren. Die kulturelle Vielfalt ist Teil ihrer Identität geworden. Es ist eine Freude, die ländertypischen Traditionen mitzuerleben, die diese Frauen in ihren Erzählungen über nahe und ferne Länder und über die eigene Lebensgeschichte lebendig werden lassen. Die Frauen sind stolz darauf! Sie haben für dieses Buch ihre Schatzkiste geöffnet und damit einen großen Reichtum offenbart.
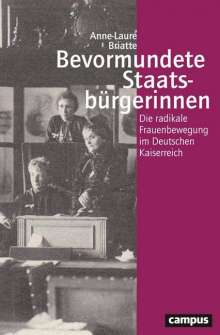
Bevormundete Staatsbürgerinnen
Die "radikale Frauenbewegung im Deutschen Kaiserreich
Anne-Laure Briatte, Campus Verlag, 2020, 490 Seiten, 49,00 €, ISBN: 9783593508276
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Am 19. Januar 1919 konnten Frauen erstmals auf nationaler Ebene in Deutschland das Wahlrecht ausüben. Nach heftig geführten Auseinandersetzungen war damit ein wichtiges Ziel des »radikalen« Flügels der Frauenbewegung des Deutschen Kaiserreichs erreicht. Anne-Laure Briatte zeichnet die bislang vernachlässigte Geschichte dieses Zweiges der deutschen Frauenbewegung nach, der sich um die Hauptakteurinnen Minna Cauer, Anita Augspurg und Lida Gustava Heymann gruppierte. Ihre Analyse der Kämpfe der »linken« Frauenrechtlerinnen, ihrer Erfolge und ihres Scheiterns schließt eine große Lücke in der Erforschung der deutschen Frauenbewegung

Junge Geflüchtete an der Grenze
Eine Ethnografie zu Altersaushandlungen
Laura K. Otto, Campus, 2020, 423 Seiten, 39,95 €, ISBN 9783593513072
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Immer mehr junge Menschen fliehen nach Europa. Nach ihrer Ankunft findet in der Regel ein Altersfeststellungsverfahren statt. Die Mitgliedstaaten der EU versuchen in den Asylverfahren das Alter der Ankommenden eindeutig zu bestimmen, denn an die Minder- und Volljährigkeit sind Aufnahmebedingungen geknüpft. Entlang von Migrationsbewegungen junger Geflüchteter aus Somalia zeigt die Autorin, wie die Kategorie des »unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlings« auf Malta hervorgebracht und verwendet wird. Zentral sind Altersaushandlungen zwischen den Geflüchteten und institutionellen Akteurinnen und Akteuren. Diese Ethnografie veranschaulicht, wie vielfältig die jungen Menschen die Einteilung als Minderjährige erleben.
Laura K. Otto, Dr. phil., ist Postdoc am Institut für Kulturanthropologie und Europäische Ethnologie der Universität Frankfurt am Main.
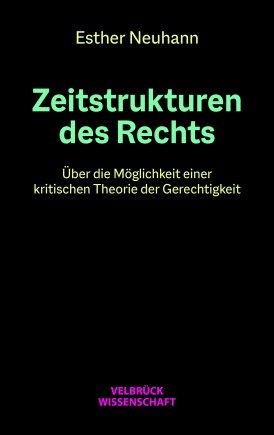
Umkämpftes Recht zu bleiben
Über die Möglichkeit einer kritischen Theorie der Gerechtigkeit
Esther Neuhann, Velbrück Wissenschaft, 2020, 400 Seiten, 34,90 €, ISBN 9783958322288
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Im Vordergrund steht die Frage, ob die »Gerechtigkeit« ein geeigneter Grundbegriff für eine kritische Theorie der Gesellschaft ist.
Die Autorin analysiert das im Kontext der Kritischen Theorie infrage stehende Konzept und bestimmt sein Verhältnis zu individuellen Rechten und positivem Recht. Davon ausgehend systematisiert sie unterschiedliche Spielarten der Skepsis an der emanzipatorischen Kraft des Gerechtigkeitsbegriffs und betont dabei die Kritik, dass eine libertäre Gerechtigkeitskonzeption Ausbeutungseffekte, eine egalitäre hingegen Normalisierungseffekte habe.
Die prozedurale Gerechtigkeitskonzeption Rainer Forsts wird darauf untersucht, ob diese die Beherrschungseffekte vermeiden kann. Dafür wird eine vollständige Rekonstruktion seiner Theorie vorgelegt. An zwei entscheidenden Stellen wird sie ergänzt und modifiziert: erstens hinsichtlich der Begründung des »Rechts auf Rechtfertigung«, die die Autorin mit Hilfe von Fichtes Anerkennungsbegriff umdeutet, und zweitens, indem das Verhältnis von Forsts Gerechtigkeitskonzeption zum modernen Recht erörtert wird.
Die Hauptthese des Buches legt dar, dass diese kritisch-prozedurale Gerechtigkeitskonzeption die Beherrschungseffekte der Ausbeutung und Normalisierung vermeidet, aber das Potential für einen neuen zweistufigen Beherrschungseffekt ausbildet: »Beschleunigung«, verstanden als stetige Verringerung der Geltungsdauer sozialer Institutionen, insbesondere rechtlicher Normen, und damit einhergehend die Subjektivierungsform der »Flexibilisierung«.
Eine Reflexion der kritisch-prozeduralen Gerechtigkeitskonzeption auf diesen in ihr angelegten Beherrschungseffekt wirft die Frage nach dem gewünschten Modus der Entwicklung des Rechts (als Realisierungsform der Gerechtigkeit) in der Zeit auf. Die Ausgangsfrage nach der Möglichkeit einer kritischen Theorie der Gerechtigkeit entscheidet sich also mit Blick auf die Zeitstrukturen des Rechts.
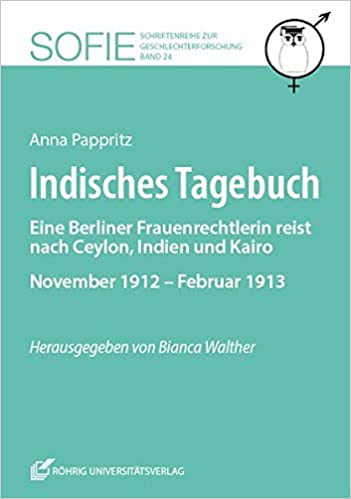
Anna Pappritz
Indisches Tagebuch. Eine Frauenrechtlerin reist nach Ceylon, Indien und Kairo.
Bianca Walther (Hg.), Röhrig Universitätsverlag, 2020, 29,00 €, ISBN: 978-3-86110-750-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Im Winter 1912/13 reiste die Berliner Frauenrechtlerin Anna Pappritz durch Indien. Diese Reise hatte der Forschung lange Rätsel aufgegeben - bis 2019 ihr verschollen geglaubtes Reisetagebuch auftauchte. Darin begegnet uns eine bildungsbürgerliche Touristin, die Landschaften und neue Eindrücke genießt, ihr Faible für Elefanten entdeckt, aber auch zweimal an Dengue-Fieber erkrankt, oft überfordert ist und zuweilen Einstellungen an den Tag legt, die uns zutiefst befremden. Das Reisetagebuch der Anna Pappritz verdeutlicht, dass die Geschichte weißer, fernreisender Frauen nicht nur eine Geschichte von Befreiung, sondern auch ein Stück Kolonialismusgeschichte ist. Diese Herausforderung gilt es, anzunehmen. Zusammen mit einer biografischen und inhaltlichen Einführung wird das Tagebuch nun erstmals der Öffentlichkeit präsentiert.
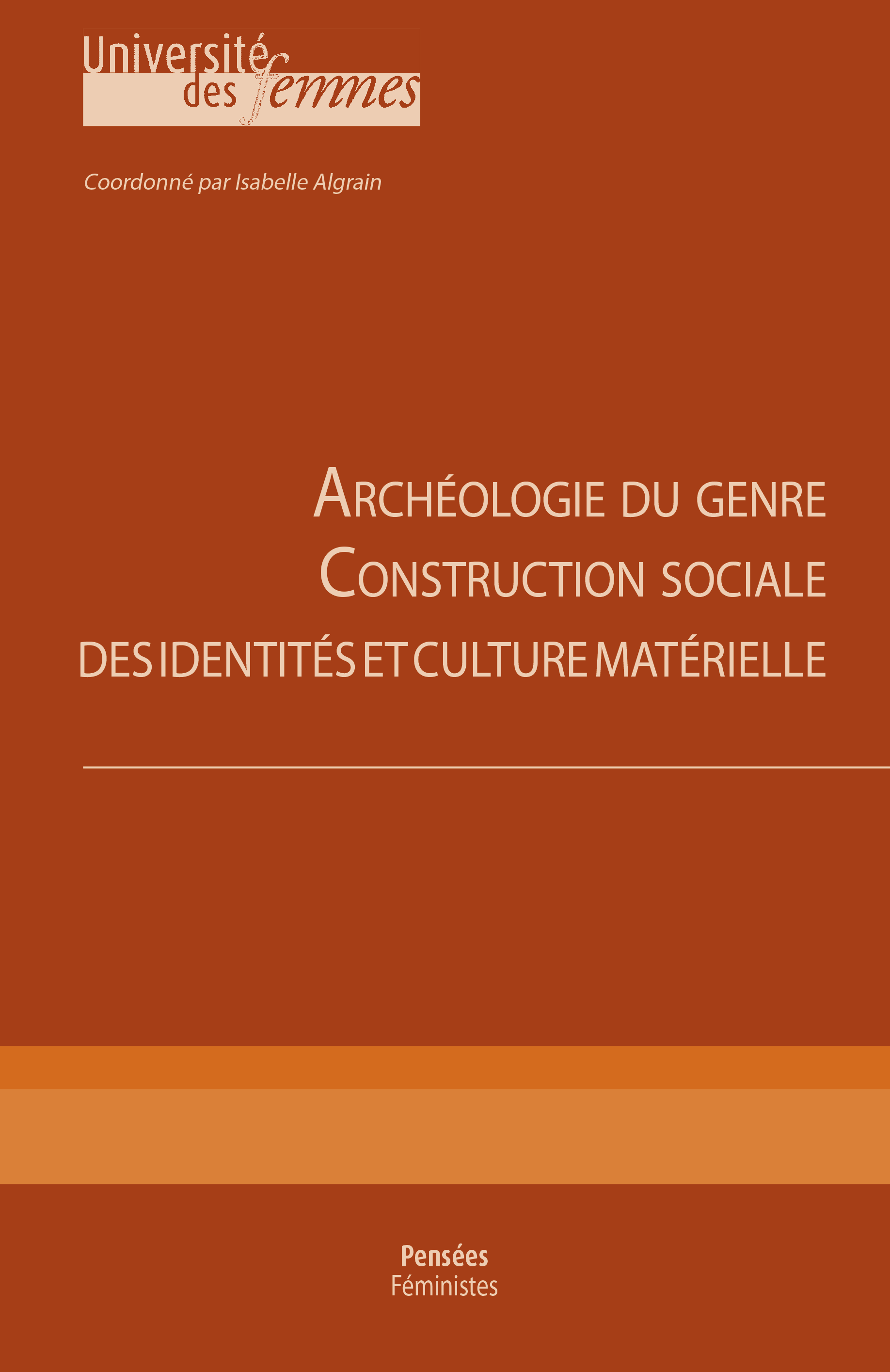
Archéologie du genre.
Construction sociale des identités et culture matérielle
Université des Femmes, Collection Pensées féministes, Brüssel, 2020, 213 Seiten, ISBN : 2-87288-059-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
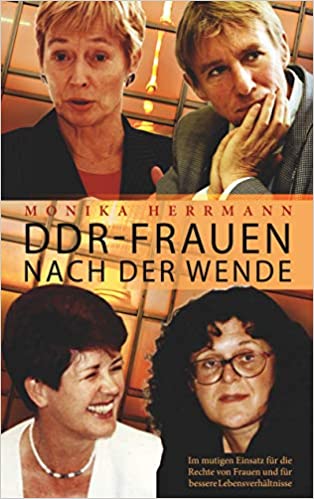
DDR-Frauen nach der Wende
Im mutigen Einsatz für die Rechte von Frauen und für bessere Lebensverhältnisse
Monika Herrmann, Verlag: Books on Demand, 2020, 7,99 Euro, ISBN: 978-3-7504-95517 und unter www.bod.de/buchshop/ddr-frauen-nach-der-wende zu beziehen, E-Book: 3,49 Euro
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Diese Dokumentation vermittelt einen Einblick in die veränderte Lebensrealität ostdeutscher Frauen nach der politischen Wende in den 1990er Jahren. Arbeitslosigkeit, wachsende soziale Unsicherheit, Verschlechterungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Debatte um den Paragraphen 218 bestimmten die frauenpolitischen Diskussionen in den neuen Bundesländern, von denen Monika Herrmann in diesem Buch berichtet. Im Rahmen ihrer Arbeit bei der Friedrich-Ebert-Stiftung war sie in den 90er Jahren für die Organisation von Veranstaltungen zuständig, die sich hauptsächlich an ostdeutsche Frauen richteten. Die Autorin lässt die Betroffenen an vielen Stellen selbst zu Wort kommen und zeigt auf, wie engagiert und kämpferisch sich die Ostfrauen gegen den Abbau ihrer Rechte im Prozess der Wiedervereinigung zur Wehr setzten.
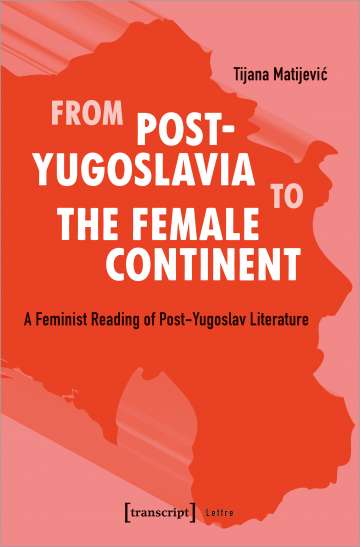
From Post-Yugoslavia to the Female Continent
A Feminist Reading of Post-Yugoslav Literature
Tijana Matijevic, transcript Verlag, 280 Seiten, 70,00 €, ISBN: 978-3-8376-5209-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
This study of contemporary literature from the former Yugoslavia (Post-Yugoslavia) follows the ways in which the feminist writing of gender, body, sexuality, and social and cultural hierarchies brings to light the past of socialist Yugoslavia, its cultural and literary itineraries and its dissolution in the Yugoslav wars. The analysis also focuses on the particularities of different feminist writings, together with their picturing of possible futures. The title of the book suggests an attempt to interpret post-Yugoslav literature as feminist writing, but also a process of conceptualizing a post-Yugoslav literary field, in this study represented by contemporary fiction from Bosnia and Herzegovina, Croatia, and Serbia.
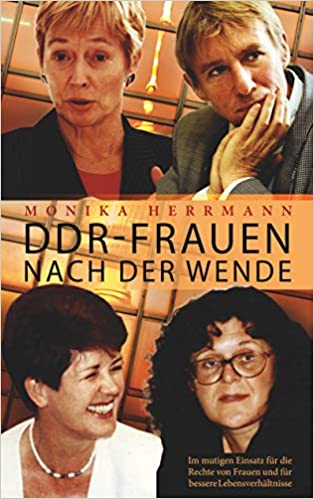
DDR-Frauen nach der Wende
Im mutigen Einsatz für die Rechte von Frauen und für bessere Lebensverhältnisse
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Diese Dokumentation vermittelt einen Einblick in die veränderte Lebensrealität ostdeutscher Frauen nach der politischen Wende in den 1990er Jahren. Arbeitslosigkeit, wachsende soziale Unsicherheit, Verschlechterungen im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Debatte um den Paragraphen 218 bestimmten die frauenpolitischen Diskussionen in den neuen Bundesländern, von denen Monika Herrmann in diesem Buch berichtet. Im Rahmen ihrer Arbeit bei der Friedrich-Ebert-Stiftung war sie in den 90er Jahren für die Organisation von Veranstaltungen zuständig, die sich hauptsächlich an ostdeutsche Frauen richteten. Die Autorin lässt die Betroffenen an vielen Stellen selbst zu Wort kommen und zeigt auf, wie engagiert und kämpferisch sich die Ostfrauen gegen den Abbau ihrer Rechte im Prozess der Wiedervereinigung zur Wehr setzten.
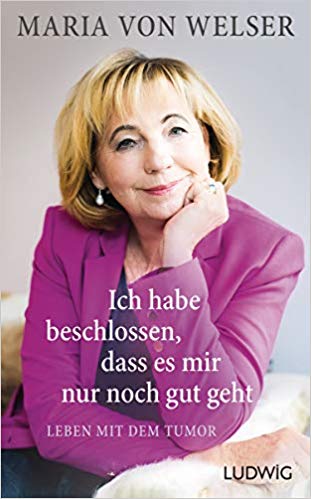
Ich habe beschlossen, dass es mir nur noch gut geht:
Leben mit dem Tumor
Maria von Welser, Ludwig Verlag, 2019, 208 Seiten, 20 €, ISBN: 978-3453281158
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Ich kämpfe weiter ─ für mich und für andere
Die Diagnose trifft Maria von Welser mitten in ihrem so geordneten, aktiven Leben: ein Gehirntumor. Es folgt eine fünfstündige OP, deren Folgen, vor allem der starke Schwindel, ihr zu schaffen machen. Doch Aufgeben ist für Maria von Welser keine Alternative. Sieben Monate nach der Entfernung des Tumors ist sie entschlossen, wieder in ihr normales Leben zurückzukehren: Sie hält Vorträge in ganz Deutschland zur Situation von Frauen auf der Welt und zur Flüchtlingsfrage – den Themen ihrer letzten beiden Bücher. Denn sie fragt sich: „Kann ich mich aus der Öffentlichkeit zurückziehen? Will ich mich auf meinen Tumor konzentrieren, wo ganz andere Krebsgeschwüre in unserem Land wuchern?"
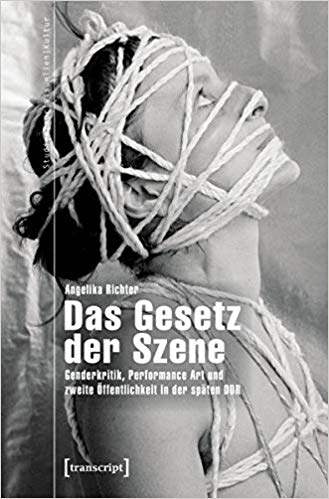
Das Gesetz der Szene
Genderkritik, Performance Art und zweite Öffentlichkeit in der späten DDR
Angelika Richter, transcript Verlag, 2019, 39,99 €, 408 Seiten, ISBN: 978-3837645729
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Eine Folge der Wiedervereinigung Deutschlands war die verstärkte Marginalisierung von Künstlerinnen aus der DDR, die als Teil einer 'genderlosen' Geschichtsschreibung zu begreifen ist. Angelika Richter fragt nach den Gründen für diesen doppelten Ausschluss, die bis in die Anfangsjahre der DDR zurückgehen. Dabei führt sie auch einer nicht im Sozialismus sozialisierten Leserschaft vor Augen, welche Effekte staatliche Emanzipationsprogramme hatten. Ihre Studie erkundet die genderspezifischen Strukturen der 'zweiten Öffentlichkeit' und unterstreicht den Stellenwert prozessbasierter Kunst für die Herausbildung dieser Sphäre. Darüber hinaus zeichnet sie nach, wie Performances tradierte Vorstellungen von Geschlecht thematisiert und kritisiert haben.
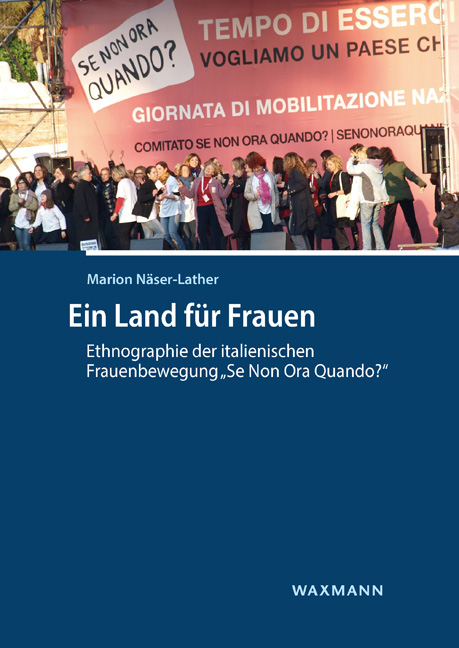
Ein Land für Frauen
Ethnographie der italienischen Frauenbewegung " Se Non Ora Quando?"
Marion Näser-Lather, 398 Seiten, Waxmann (Verlag), 2019, 44,90 €, 978-3-8309-4031-9 (ISBN)
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die gesellschaftliche Benachteiligung von Frauen und das sexistische Frauenbild in den Medien war 2011 in Italien Anlass zur Gründung der feministen Bewegung Se Non Ora Quando? (wenn nicht jetzt, wann dann?). Diese Ethnographie untersucht Strukturbildungsprozesse, politische Visionen, Kommunikationsformen und Protestpraktiken der Bewegung. Die Autorin beleuchtet die Frage politischen Engagements auf der Basis der Kategorie Geschlecht und zeigt unter anderem am Beispiel des Umgangs mit digitalen Medien, dass die Möglichkeitsräume aktivistischen Denkens und Handelns in hohem Maße von Überzeugungen und Interaktionstraditionen beeinflusst werden können, die sich auch entgegen der Intentionen der Aktivistinnen in deren Diskurse und Praktiken einschreiben. Als fruchtbar für die Analyse der zugrundeliegenden Dynamiken erweist sich das in der Europäischen Ethnologie bislang noch nicht bekannte Konzept der sozialen Automatismen.
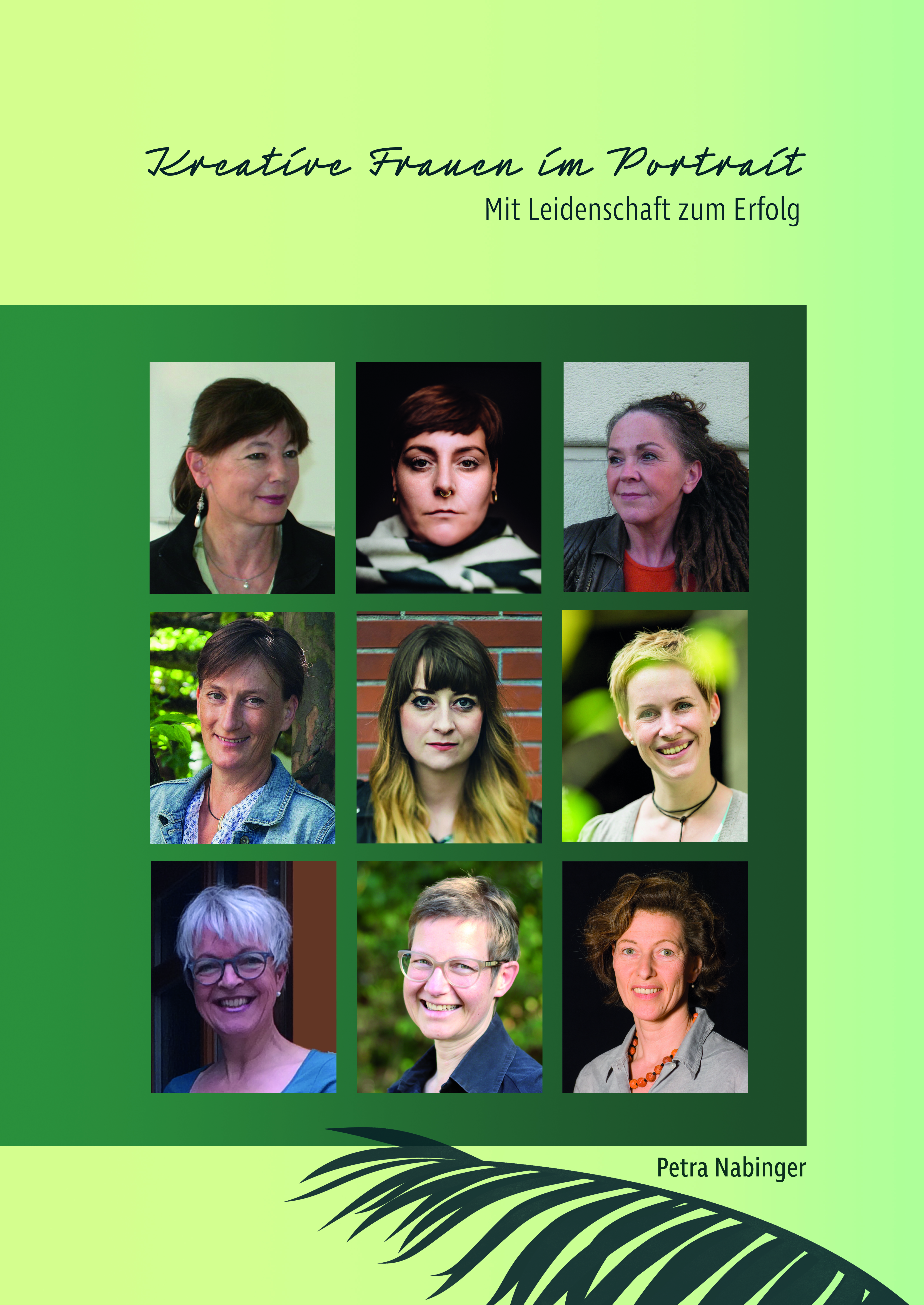
Kreative Frauen im Portrait
Mit Leidenschaft zum Erfolg
Petra Nabinger, Littera-Verlag 2019, 191 Seiten, 12,90 €, ISBN 978-3-945734-29-2
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Erfahren Sie aus zehn spannenden und sehr unterschiedlichen Portraits über kreative Frauen, wie es möglich ist, mit Leidenschaft erfolgreich zu sein. Es ist eine kurzweilige Reise, die - wie bei einem Märchen – im Schloss beginnt und uns wie bei 1001 Nacht – bis in den Norden Afrikas führt. Lassen Sie sich von diesen zehn Frauen verzaubern und mitnehmen auf eine abenteuerliche Reise. Erfahren Sie auch etwas über die Chancen im Leben,die sich aus vermeintlichen Niederlagen ergeben können.

Erinnern, vergessen, umdeuten?
Europäische Frauenbewegungen im 19. Und 20. Jahrhundert
Angelika Schaser, Sylvia Schraut, Petra Steymans-Kurz (Hg.), Campus Verlag, 2019, 406 Seiten, 43,00 €, ISBN: 9783593510330
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die erste Frauenbewegung leitete am Ende des 19. und im frühen 20. Jahrhundert erste wichtige Schritte zur Emanzipation und Gleichberechtigung in Europa ein. Ihre Ziele, Aktionen und Errungenschaften blieben allerdings nicht in der kulturellen Erinnerung verankert. Denn als sich die zweite Frauenbewegung in den 1970er Jahren auf den politischen Bühnen Gehör verschaffte, verstand sie sich weitgehend als neue Bewegung ohne Vorläufer. Die Beiträge dieses Bandes untersuchen die Bilder der eigenen Geschichte, die die europäischen Frauenbewegungen entwickelten oder vernachlässigten, und die Traditionsverluste, die durch die Diktaturen des 20. Jahrhunderts verursacht wurden.
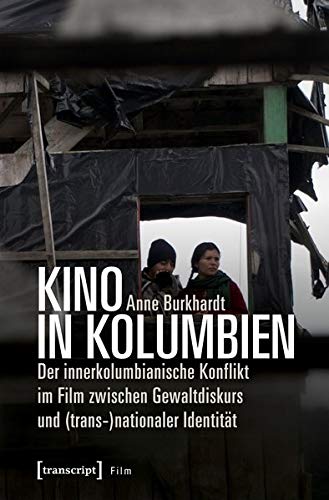
Kino in Kolumbien
Der innerkolumbianische Konflikt im Film zwischen Gewaltdiskurs und (trans-)nationaler Identität
Anne Burkhardt, transcript Verlag, 2019, 422 Seiten, 49,99 €, ISBN: 978-3-8376-4673-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Der landesinterne Konflikt in Kolumbien und die damit einhergehende Gewalt sind seit deren Ausbruch in den 1940er Jahren zentraler Gegenstand des kolumbianischen Kinos. Unter dem Einfluss sich wandelnder Gewaltdiskurse und Produktionsbedingungen entwerfen die kolumbianischen Filmemacher_innen vielschichtige Porträts der kolumbianischen Gesellschaft und liefern neue Ansätze zur Reflexion und Bewertung der Gewalt in Kolumbien. Anne Burkhardts diskursanalytisch fundierte Untersuchung von 17 ausgewählten Filmen, darunter einige Klassiker des kolumbianischen Kinos, wird ergänzt um die erste umfassende Darstellung der kolumbianischen Filmgeschichte in deutscher Sprache.
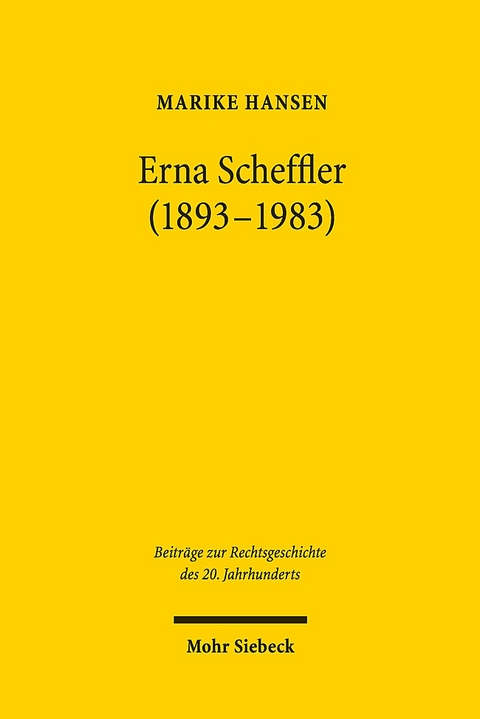
Erna Scheffler (1893-1983)
Erste Richterin am Bundesverfassungsgericht und Wegbereiterin einer geschlechtergerechten Gesellschaft
Marike Hansen, Mohr Siebeck (Verlag), 2019, 209 Seiten, 64,00 €, ISBN: 978-3-16-157602-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Erna Scheffler war nicht nur eine Ausnahmejuristin, die von 1951 bis 1963 als erste Richterin am Bundesverfassungsgericht an maßgeblicher Stelle die Rechtsentwicklung der jungen Bundesrepublik mitgestaltete, sondern auch eine der einflussreichsten Kämpferinnen für die Gleichberechtigung von Frauen im 20. Jahrhundert. In ihrer Monographie zeichnet Marike Hansen den eindrucksvollen Lebensweg dieser - bis heute auch unter Juristen wenig bekannten - Persönlichkeit im Kontext der Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland nach. Sie zeigt, dass nicht zuletzt die zahlreichen Beschränkungen und Diskriminierungen, denen sich Erna Scheffler im Laufe ihres eigenen Werdeganges ausgesetzt sah, diese zu ihrem nachhaltigen Kampf für Geschlechtergerechtigkeit motivierten. Als Bundesverfassungsrichterin der ersten Stunde war sie schließlich an wichtigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau beteiligt und konnte so entscheidende Impulse für die Durchsetzung der Frauenrechte unter dem Grundgesetz setzen. Erna Scheffler war nicht nur eine Ausnahmejuristin, die von 1951 bis 1963 als erste Richterin am Bundesverfassungsgericht an maßgeblicher Stelle die Rechtsentwicklung der jungen Bundesrepublik mitgestaltete, sondern auch eine der einflussreichsten Kämpferinnen für die Gleichberechtigung von Frauen im 20. Jahrhundert. In ihrer Monographie zeichnet Marike Hansen den eindrucksvollen Lebensweg dieser - bis heute auch unter Juristen wenig bekannten - Persönlichkeit im Kontext der Entwicklung der Frauenrechte in Deutschland nach. Sie zeigt, dass nicht zuletzt die zahlreichen Beschränkungen und Diskriminierungen, denen sich Erna Scheffler im Laufe ihres eigenen Werdeganges ausgesetzt sah, diese zu ihrem nachhaltigen Kampf für Geschlechtergerechtigkeit motivierten. Als Bundesverfassungsrichterin der ersten Stunde war sie schließlich an wichtigen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zur Frage der Gleichberechtigung von Mann und Frau beteiligt und konnte so entscheidende Impulse für die Durchsetzung der Frauenrechte unter dem Grundgesetz setzen.

Adoleszenz, Geschlecht, Identität
Queere Konstruktionen in Romanen nach der Jahrtausendwende
Nadine Maria Seidel, Peter Lang Verlag, 2019, 252 Seiten, 49,95 €, ISBN 978-3-631-77351-2
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Das Buch behandelt unterschiedliche literarische Inszenierungen von Geschlechterkonstruktionen. Dabei werden exemplarische Figurentypen auf ihr subversives Potential bezüglich Heteronormativität befragt. Es erweist sich, dass allen Texten implizite und explizite Aussagen über Geschlecht inhärent sind, die sich widersprechen. Die Autorin zeigt auf, wie diese Aussagen durch unterschiedliche Methoden extrahiert werden können.
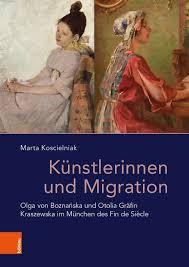
Künstlerinnen und Migration
Olga von Boznanska und Otolia Gräfin Kraszewska im München des Fin de Siècle
Marta Koscielniak, Böhlau Verlag, 2019, 360 Seiten, 55,- €, ISBN 978-3-412-51398-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Olga von Boznańska (1865–1940) und Otolia Gräfin Kraszewska (1859–1945) gehören der ersten Generation von Künstlerinnen an, die professionell tätig waren und damit auch teilweise ihren Lebensunterhalt selbst bestritten. Die beiden Polinnen begegneten sich während der 1880/90er Jahre in München und bauten von dort aus je eine eigenständige internationale Karriere auf.
Marta Koscielniak erforscht die Netzwerkstrukturen und Traditionslinien innerhalb ihres Umfelds. Sie erschließt die Handlungsoptionen in Ausrichtung auf den deutschen wie den polnischen Rezeptionsraum. Im Vordergrund stehen dabei die Bilder und Identitätspolitiken sowie die Migration von Künstlerinnen in ihren zeitspezifischen Ausprägungen.
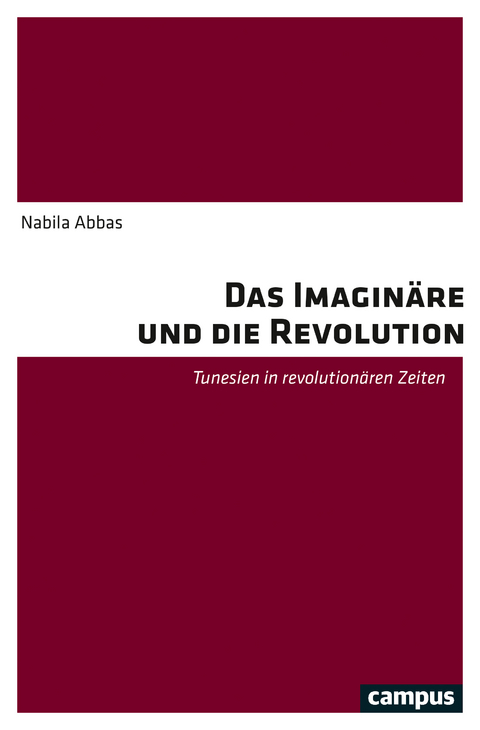
Das Imaginäre und die Revolution
Tunesien in revolutionären Zeiten
Nabila Abbas, Campus Verlag, 2019, 486 Seiten, 35,99 €, ISBN: 978-3-593-51153-5
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Im Jahr 2011 bricht die tunesische Revolution aus. Bürgerinnen und Bürger besetzen im ganzen Land öffentliche Plätze, fordern politische Freiheits- und Gleichheitsrechte und soziale Gerechtigkeit. In dieser Studie kommen die Akteurinnen und Akteure der Revolution zu Wort. So werden ihre Motive und ihre politischen Vorstellungen sichtbar. Das Buch gibt Aufschluss über die ideellen Wurzeln der Revolution und fragt nach den Entstehungsbedingungen politischer Praxis und Vorstellungskraft in Kontexten von Protesten.
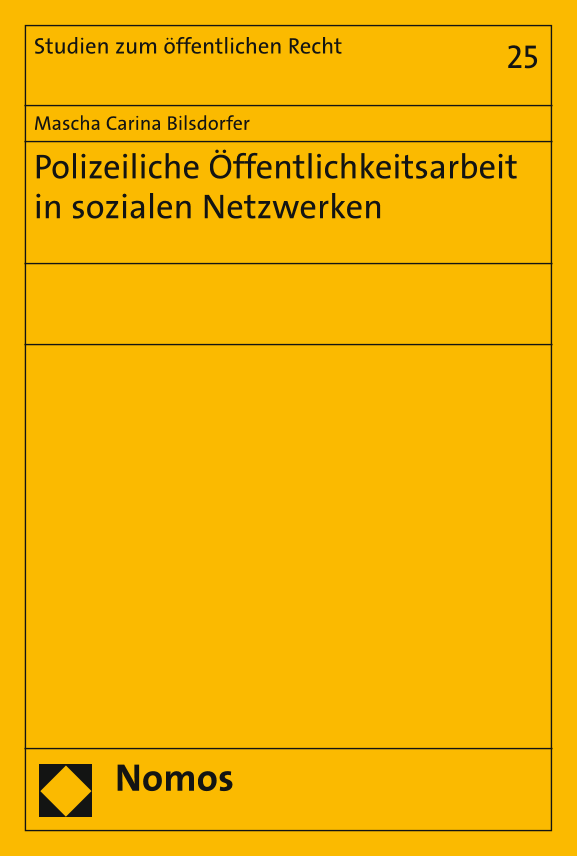
Polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit in sozialen Netzwerken
Mascha Carina Bilsdorfer, Nomos, 2019, 509 Seiten, 129,00 €, ISBN: 978-3-8487-6335-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit in den sozialen Netzwerken ist derzeit ein allgegenwärtiges Thema. Auch wenn polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit bereits seit Jahrzehnten betrieben wird, hat sie durch die Übertragung auf ein neues Medium in Form der sozialen Netzwerke neuen Aufschwung erfahren. Hiermit verbunden sind dabei sowohl datenschutzrechtliche, verfassungsrechtliche als auch verwaltungsrechtliche Problemfelder, die vorliegend vertieft wissenschaftlich analysiert werden. Das Werk stellt insbesondere eindeutige rechtliche Vorgaben auf, die bei der Kommunikation über die sozialen Netzwerke eingehalten werden müssen. Denn mit der Übertragung der polizeilichen Öffentlichkeitsarbeit auf die sozialen Netzwerke ist keineswegs eine Aufgabe der bisher geltenden rechtlichen Maßstäbe verbunden, auch wenn der eher locker gehaltene Kommunikationsstil und die Erwartungshaltung der Social Media User dazu verleitet, die über Jahre hinweg entwickelten rechtlichen Maßgaben zu vernachlässigen.
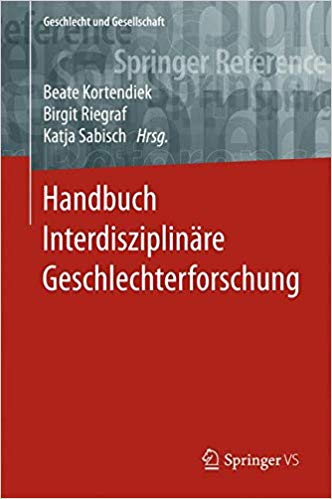
Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung
Kortendiek, Beate, Riegraf, Birgit, Sabisch, Katja (Hrsg.), VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2019, 1566 Seiten, 149,99 €, ISBN 978-3-658-12495-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Das Handbuch bietet einen systematischen Überblick über den Stand der Geschlechterforschung. Disziplinäre und interdisziplinäre Zugänge werden verknüpft und vielfältige Sichtweisen auf das Forschungsfeld eröffnet. Die Beiträge der Geschlechterforscher_innen aus unterschiedlichen Fachdisziplinen spannen die Breite des Forschungs- und Wissenschaftsfeldes auf. Hierdurch werden die Debatten, Analysen und Entwicklungen der deutschsprachigen und internationalen Geschlechterforschung deutlich.
Das Handbuch Interdisziplinäre Geschlechterforschung ist in sieben Schwerpunkte gegliedert und besonders in Lehre und Forschung einsetzbar.
Herausgegeben von
Dr. Beate Kortendiek ist Leiterin der Koordinations- und Forschungsstelle des Netzwerks Frauen- und Geschlechterforschung NRW an der Universität Duisburg-Essen.Dr. Birgit Riegraf ist Professorin für Allgemeine Soziologie an der Universität Paderborn.Dr. Katja Sabisch ist Professorin für Gender Studies an der Universität Bochum.Aufsatz über Mentoring von Prof. Dr. Anne Schlüter:
Er geht der Frage nach: Mentoring: Instrument einer gendergerechten akademischen Personalentwicklung?
S.1023-1032.
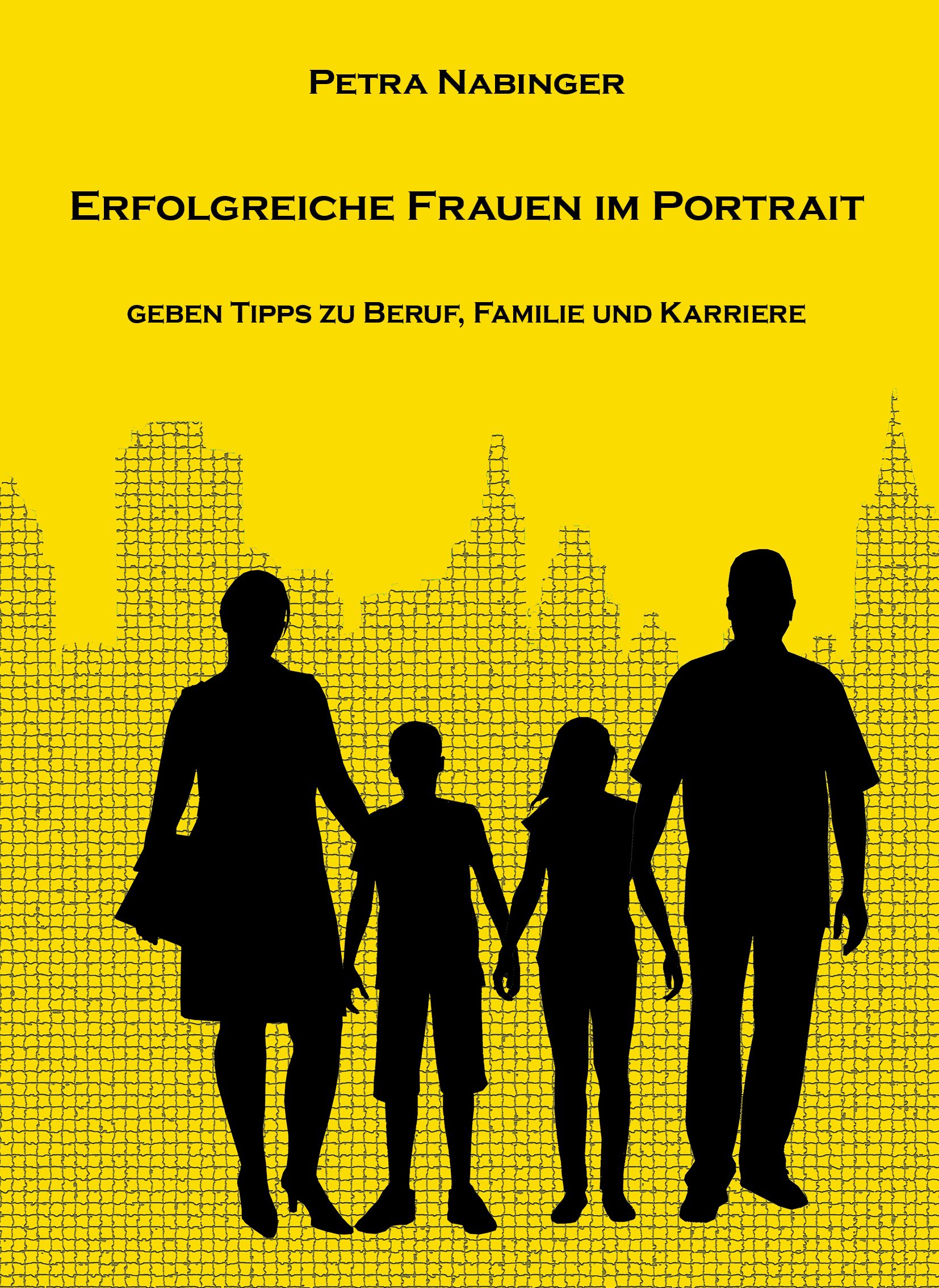
Erfolgreiche Frauen im Portrait
Geben Tipps zu Beruf, Familie und Karriere
Petra Nabinger, LITTERA-Verlag, 2018, 167 Seiten, 9,90€, ISBN: 978-3945734278
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Fünf erfolgreiche Frauen erzählen, wie es ihnen gelungen ist, den Weg nach oben zu meistern. Sie berichten über vielfältige Erfahrungen, zu denen auch Niederlagen gehören. Dadurch können sie zum Vorbild werden und junge Frauen ermutigen, mit Erfolg durchzustarten. Aber auch erfahrene Frauen im mittleren Alter orientieren sich oft neu, nach einer familiär bedingten Auszeit oder nach einem Betriebs- oder Berufswechsel. Auch für sie gibt es Aufstiegschancen, gerade im Hinblick auf den zunehmenden Bedarf an qualifizierten Fach- und Führungskräften.
Die Frauen und deren Unterstützer erhalten wertvolle Tipps für die Karriereplanung. Auf Bausteine, wie das Mentoring, Netzwerken und Coaching geht das Buch ebenso ein, wie auf Charaktereigenschaften und die Eigeninitiative. Das Buch könnte für kreative Manager mit Weitblick eine wichtige Lektüre werden, wenn sie in ihrem Unternehmen Aufstiegsperspektiven für Frauen schaffen wollen. Wer die unterschiedlichen Verhaltensmuster der beiden Geschlechter kennt, kann gezielter geeignete Rahmenbedingungen setzen und zum Gestalter einer ausgewogenen Managementkultur werden.
Das Buch zeigt, dass es nicht nur möglich, sondern auch von großer gesellschaftlicher Bedeutung ist, die Karriere mit der Familienplanung zu vereinbaren. Hierzu kommen zwei karriereorientierte Mütter zur Sprache. In ihrem Vorwort weist die Personalexpertin Christiane Flüter-Hoffmann auf die Bildungsexpansion der Frauen hin: Gegenwärtig strömt die am besten ausgebildete Frauengeneration aller Zeiten auf den Arbeitsmarkt.
Henrike von Platen, die durch ihr frauenpolitisches Engagement international bekannt wurde, schließt die spannende Reise durch die Biografien mit einem ´Plädoyer für politischen Mut´ ab.
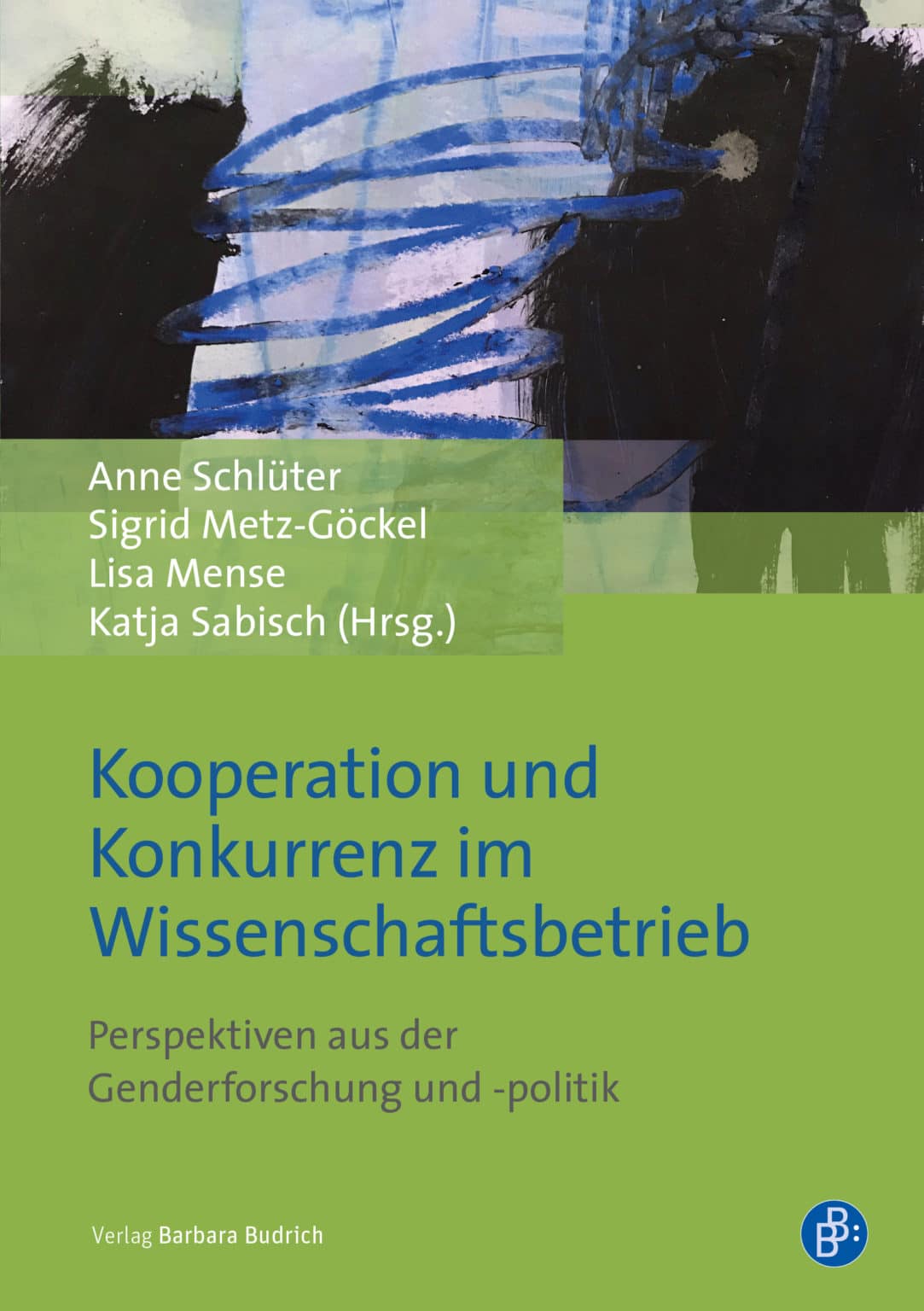
Kooperation und Konkurrenz im Wissenschaftsbetrieb
Perspektiven aus der Genderforschung und -politik
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Frauen- und Geschlechterforschung begann als Provokation für die Wissenschaftstradition und ist längst (maßgeblich) an ihrer Erneuerung beteiligt, wie sich an der personellen Zusammensetzung des wissenschaftlichen Personals zeigt. In den Auseinandersetzungen um egalitäre Geschlechterverhältnisse in Wissenschaft und Gesellschaft spielen Kooperation und Solidarität unter den Frauen/Geschlechterforscherinnen eine große Rolle. Aber auch Konkurrenz und Streit um Positionen und das ‚richtige‘ Verständnis ziehen sich wie rote Fäden durch ihre Entwicklungsgeschichte. Geschichte wird auch durch Personen und ihre Vorstellungen bestimmt, hier den engagierten Frauen. Ihnen wird große Aufmerksamkeit gewidmet, ebenso den Akteurinnen und der subjektiven Seite der scheinbar objektiven Bedingungen. Das 21. Jahrhundert wird das Jahrhundert der Frauen sein.
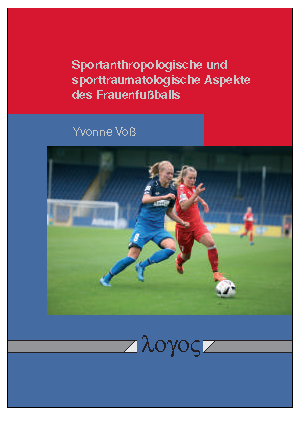
Sportanthropologische und sporttraumatologischeAspekte des Frauenfußballs
Yvonne Voß, Logos Verlag, 2018, S. 448, 45.00 €, ISBN 978-3-8325-4707-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Frauenfußball gewinnt nicht nur in Deutschland immer mehr an Popularität. Trotz steigender Professionalisierung existiert weiterhin ein großer Nachholbedarf bezüglich Frauenfußball-spezifischen anthropologischen Untersuchungen zur Verbesserung von Talentsuche und -förderung, Trainingsmethodik und Ernährung.Durch den Vergleich anthropologischer Messwerte gibt die vorliegende Arbeit Aufschluss darüber, inwieweit körperliche Unterschiede zwischen einem hochrangigem Fußballspielerinnen-Kollektiv und einer Kontrollgruppe von "normalen" sportlichen jungen Frauen bestehen und ob sich außerdem Differenzen zwischen den einzelnen Spielpositionen (Abwehr, Mittelfeld, Sturm, Tor) herauskristallisieren.
Die Erfassung der sportartspezifischen Verletzungen der Fußballspielerinnen ermöglicht den Vergleich der Verletzungsanfälligkeit der unterschiedlichen Spielpositionen bzw. der Konstitutionstypen.
Dieses Buch richtet sich an Sportwissenschaftler*innen, Sportmediziner*innen, Anthropolog*innen und Fußballtrainer*innen.
Yvonne Voß hat Sportwissenschaften an der J. W. Goethe-Universität in Frankfurt am Main studiert und an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg im Fachbereich Sportwissenschaft promoviert. Zusätzlich absolvierte sie die Ausbildung zur Heilpraktikerin mit erfolgreicher Zulassung und dem Schwerpunkt in der Fachrichtung „Traditionelle Chinesische Medizin“. Seit fast 20 Jahren ist sie erfolgreiche Personal Trainerin in den Bereichen Gesundheits- und Ernährungsberatung für Firmen, Sportmediziner, öffentliche Einrichtungen und Einzelpersonen. Zusätzlich unterstützt sie Vereine und Athleten in der Wettkampfvorbereitung.
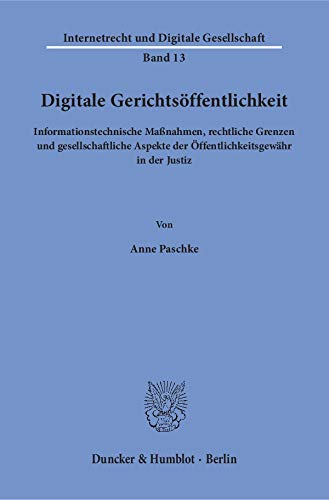
Digitale Gerichtsöffentlichkeit
Informationstechnische Maßnahmen, rechtliche Grenzenund gesellschaftliche Aspekte der Öffentlichkeitsgewähr in der Justiz
Anne Paschke, Duncker & Humblot Verlag, 2018, S. 486, 109,90 €, ISBN 978-3-428-15517-0
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Welche Rolle darf und muss das Internet mit den neuen Möglichkeiten der Digitalisierung bei der Herstellung von Gerichtsöffentlichkeit spielen? Soll es neben der persönlichen Anwesenheit von Bürgern in einer Gerichtsverhandlung (sog. Saalöffentlichkeit) und der Information über Gerichtsverhandlungen durch Presse und Rundfunk (sog. Medienöffentlichkeit) auch eine digitale Gerichtsöffentlichkeit in Form von Videoübertragungen mit begleitenden Verfahrensinformationen über ein Justizportal im Internet geben? Die Arbeit widmet sich der rechtlichen und technischen Gestaltung einer verfassungskonformen digitalen Öffentlichkeitsgewähr unter Berücksichtigung der Rechte von Verfahrensbeteiligten. Am Ende stehen konkrete Reformvorschläge. Sie knüpfen an die E-Justice- und Open-Data-Entwicklung der letzten Jahre an. Unter dem Leitbild »Rechtsschutz durch Technikgestaltung« entwickelt die Autorin ein Modell zeitgemäßer, tatsächlich wirksamer externer Legitimation und Kontrolle der Justiz.

Architektur als Akteur?
Zur Soziologie der Architekturerfahrung
Theresia Leuenberger, transcript Verlag, 2018, S. 390, 39,99 €, ISBN: 978-3-8376-4264-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Erfahren Nutzer_innen Gebäude so, wie es sich die Architekt_innen vorgestellt haben? Fühlen sie sich »eingeladen« oder eher »ausgeschlossen«?
Mit theoretischen Grundlagen aus Raumsoziologie, Praxistheorie und Akteur-Netzwerk-Theorie definiert und untersucht Theresia Leuenberger Architekturerfahrungen anhand des Kunsthaus Bregenz und der Kunsthal Rotterdam. Mit der Methode der Rekonstruktiven Sozialforschung zeigt sie, wie emotionale und rationale Gehalte von Erfahrungen aufeinander einwirkend Praktiken der Architekturerfahrung konstituieren. Dabei stellt sich heraus, dass diese nur bei übereinstimmenden Subjektpositionen oder im Falle einer Vorzeichnung durch das Gebäude den Vorstellungen der Architekten Peter Zumthor und Rem Koolhaas gleichen.
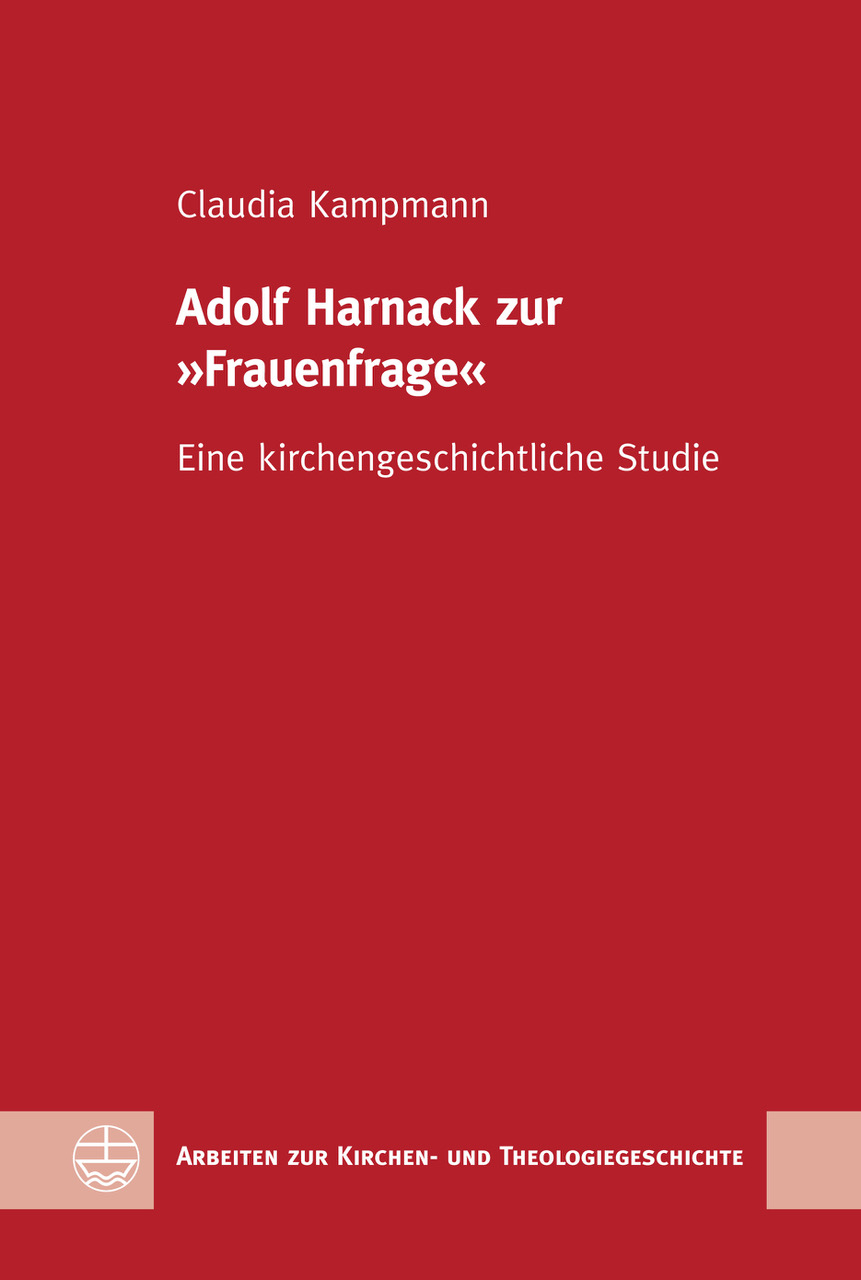
Adolf Harnack zur »Frauenfrage«
Eine kirchengeschichtliche Studie
Claudia Kampmann, Arbeiten zur Kirchen- und Theologiegeschichte, 2018, 688 Seiten, 98,- €, ISBN 978-3-374-05395-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Der evangelische Theologe und Kirchenhistoriker Adolf Harnack (1851–1930), der als der wissenschaftspolitisch wichtigste Gelehrte im Kaiserreich anzusehen ist, engagierte sich seit 1890 für die zeitgenössische »Frauenfrage«. Er griff dazu auf seine Netzwerke in der Kultusbürokratie sowie im Kaiserhaus zurück und knüpfte neue Verbindungen zur bürgerlichen Frauenbewegung.
Diese Studie rekonstruiert aufgrund umfangreicher Recherchen in mehr als einem Dutzend Archiven Harnacks Beschäftigung mit der »Frauenfrage« im Evangelisch-Sozialen Kongress, seine Beteiligung an der Reform des höheren Mädchenschulwesens, die Förderung eigener Schülerinnen an der Universität und seine kirchenhistorischen Forschungen zu Frauen in der Alten Kirche.
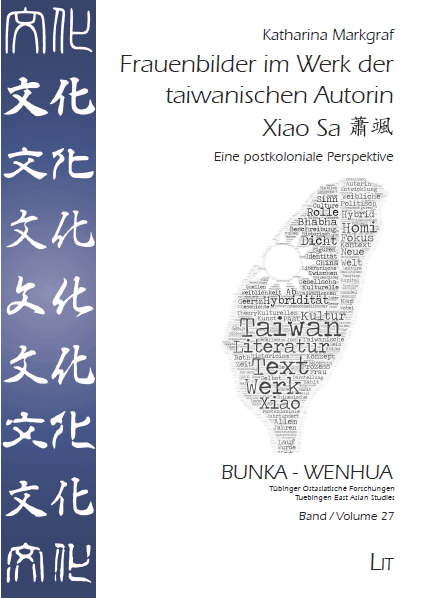
Frauenbilder im Werk der taiwanischen Autorin Xiao Sa
Eine postkoloniale Perspektive
Katharina Markgraf, LIT Verlag, 2018, 279 Seiten, 34,90 €, ISBN-13: 9783643140517
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In den 1980er Jahren fanden in Taiwan maßgebliche kulturelle, gesellschaftliche und politische Umbrüche statt, mit denen Fragen nach kultureller und personaler Identität einhergingen. Die Autorin Xiao Sa (geboren 1953) beschreibt in ihrem Werk Konzepte von Weiblichkeit aus verschiedenen Perspektiven und greift damalige Diskurse auf. Diese literarischen Entwürfe weiblicher Identität in Taiwan werden in vorliegender Studie mit Konzepten des Postkolonialismus verknüpft. Wie konstituiert sich Weiblichkeit in den Texten Xiao Sas und wie reflektiert diese die Hybridität der taiwanischen Kultur?
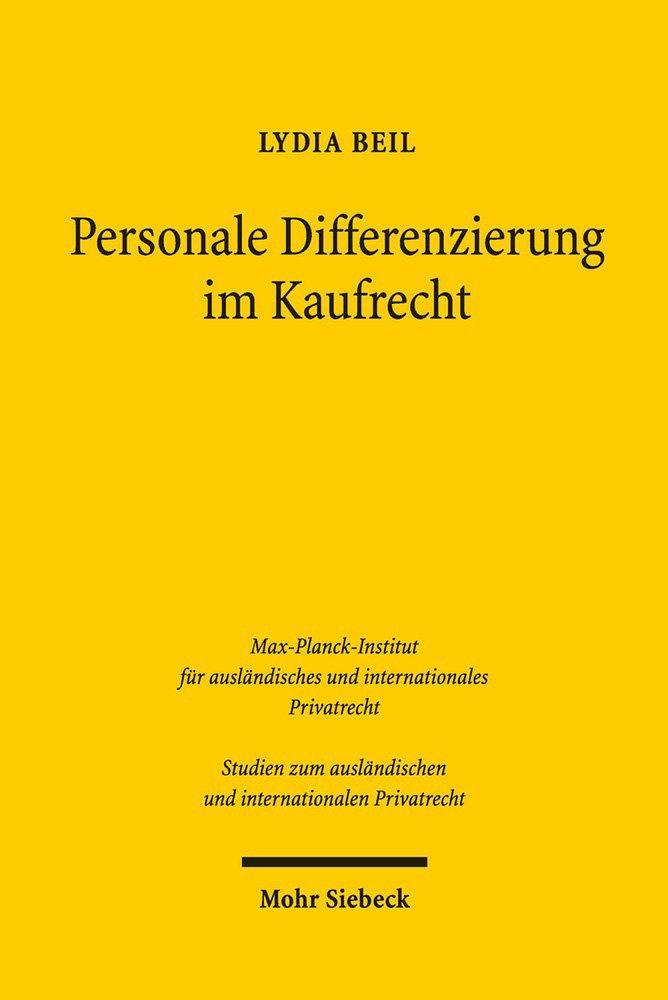
Personale Differenzierung im Kaufrecht
Lydia Beil, Mohr Siebeck, 2018, 337 Seiten, 64,- €, ISBN 978-3-16-156130-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Benötigen wir ein spezielles Kaufrecht für Verbrauchsgüterkauf- oder Unternehmerkaufverträge? Die aktuelle Situation ist paradox: In Deutschland versuchen Rechtsprechung und Gesetzgebung seit Jahren, einheitliche Regelungen für alle Personen zu schaffen und müssen dabei regelmäßig im Konflikt mit dem Europäischen Gerichtshof neue Ausnahmen für Verbraucherverträge einfügen oder Begriffe »gespalten auslegen«. In Frankreich existieren sogar zwei (bzw. drei) komplette Kaufrechts-Regime nebeneinander. In beiden Fällen ist die Rechtslage für den juristischen Laien unmöglich zu verstehen. Lydia Beil untersucht anhand eines umfassenden Vergleichs nationaler und internationaler Kaufrechtsinstrumente und unter Verwendung der ökonomischen Analyse, welche Differenzierungen dabei noch sachlich gerechtfertigt sind. Damit trägt sie insbesondere auch zur Diskussion um einen sinnvollen Inhalt für ein zukünftiges einheitliches europäisches Kaufrechtsinstrument bei.
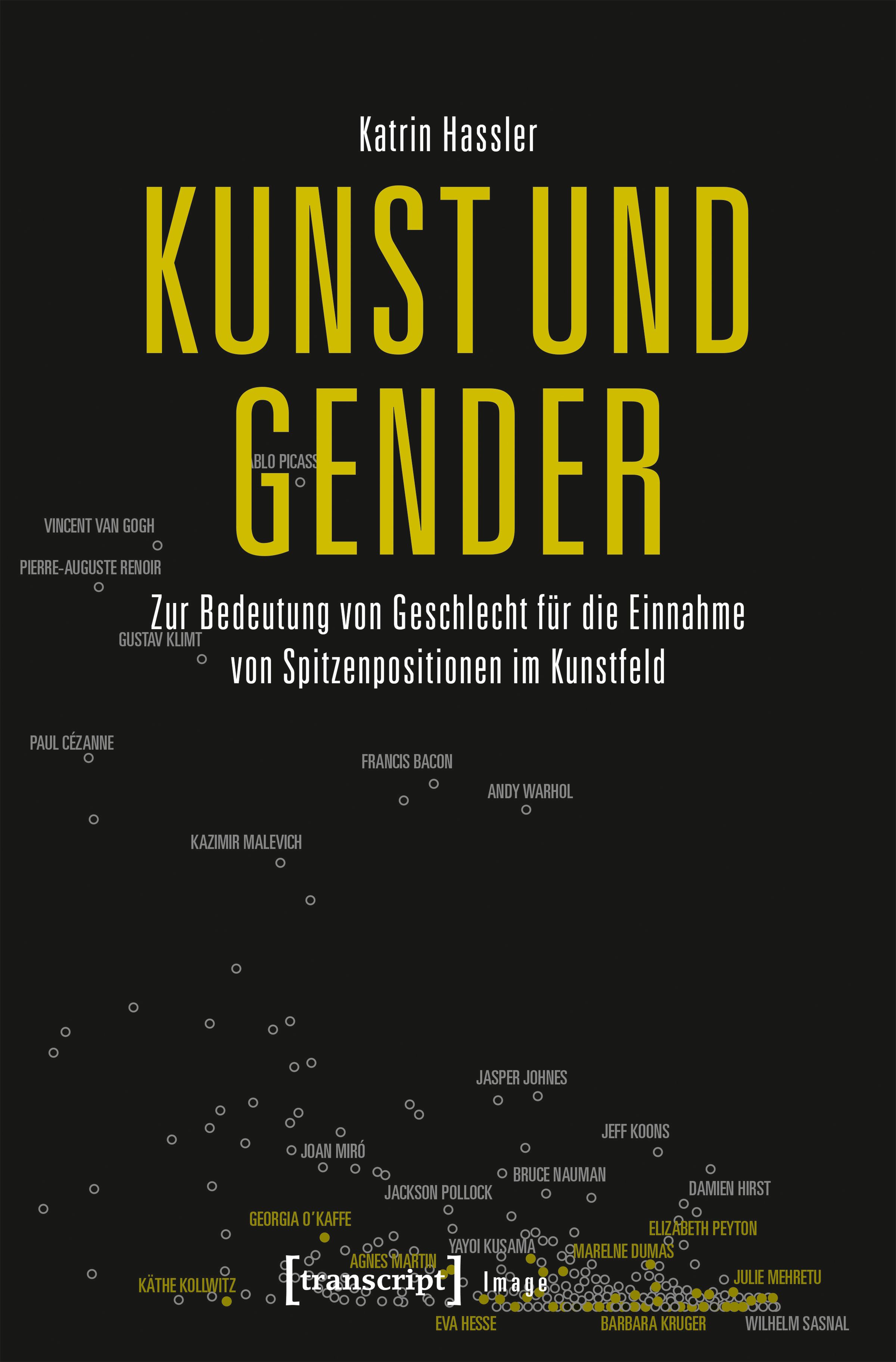
Kunst und Gender
Zur Bedeutung von Geschlecht für die Einnahme von Spitzenpositionen im Kunstfeld
Katrin Hassler, Transcript, 2017, S. 306, 37,99 €, ISBN-10: 3837639908
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Quantitative Perspektiven spielen in dem seit den 1970er Jahren intensivierten Diskurs um Kunst und Gender eine marginale Rolle. In besonderem Maße trifft dies für Positionen im Spitzensegment des internationalen Felds zu.
Katrin Hassler greift diese Leerstelle auf und liefert konkrete Zahlen zur Einnahme professioneller Positionen in diesem oft als feminisiert deklarierten Universum. Verschränkungen von Geschlecht, geografischer Herkunft und Bildungskapital sowie diachrone Entwicklungen stehen im Fokus und werden mittels des Ansatzes einer Gender-Kunstfeld-Theorie feldspezifisch analysiert, ohne dabei gesellschaftliche Machtverhältnisse aus dem Blick zu verlieren.
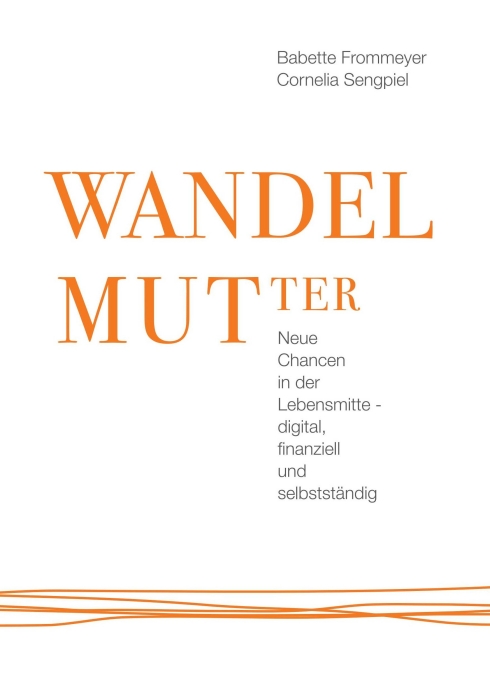
WANDELMUTter
Neue Chancen in der Lebensmitte - digital, finanziell und selbstständig
Babette Frommeyer & Cornelia Sengpiel, Verlag: tredition, 2017, 256 Seiten, 16,99 €, ISBN: 978-3-7439-6597-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Dieses Buch wendet sich an Frauen mit dem Wunsch nach Veränderung. Es ist erfrischend anders - denn es vereint drei bisher noch nie kombinierte Ansätze, um die Leserinnen ganz konkret in ihrer Suche nach Antworten zu unterstützen. Es...
- analysiert, wie viele der heutigen Frauen geprägt wurden, mit welchen Folgen – und Chancen.
- inspiriert und gibt einen Einblick in aktuelle Themen, denen Frauen oft zurückhaltend gegenüberstehen: Digitalisierung, Finanzen, Selbständigkeit.
- begleitet mit einem Workbook die Leserin in der individuellen Weiterentwicklung ihres Lebensmodells, ihrem beruflichen wie persönlichen "Sowohl-als-auch".
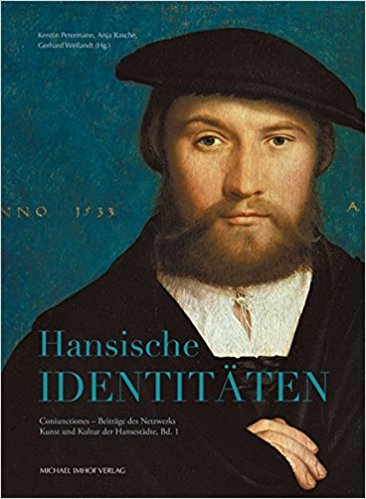
Hansische Identitäten
Coniunctiones – Beiträge des Netzwerks Kunst und Kultur der Hansestädte, Band 1
Kerstin Petermann, Anja Rasche, Gerhard Weilandt (Hg.), Michael Imhof Verlag, 232 Seiten, 113 Farb- und 10 S/W-Abbildungen, 39,95€, ISBN 978-3-7319-0513-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Gab es eine hansische Identität? Oder existierten sogar mehrere? Welche wesentlichen Merkmale im Selbstverständnis von Personen prägen Geschichte, Kunst und Kultur im Hanseraum? Diese Fragen erwiesen sich als ausgesprochen fruchtbar für die wissenschaftliche Tagung „Hansische Identitäten" am Wissenschaftskolleg Greifswald, obwohl oder gerade weil es keine einfachen Antworten darauf gibt.
Die Beiträge des Tagungsbandes zeigen ein weites Spektrum an Forschungsthemen: von Ergebnissen einer archäologischen Großgrabung im Lübecker Gründerviertel bis zum Leitbild des Hanseaten in der Nachkriegszeit. Die Beiträge von internationalen ForscherInnen aus Dänemark, Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Polen mit multidisziplinären Perspektiven ergeben ein facettenreiches Bild aktueller Hanseforschung, regen zum Weiterdenken, gemeinsamen Forschen und intensiven Austausch an.

Pionierinnen der empirischen Sozialforschung im Wilhelminischen Kaiserreich
Wissenschaft, Politik und Gesellschaft - Band 8
Marion Keller, Franz Steiner Verlag, 2017, 444 Seiten, 66€, ISBN 978-3515119856
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Mit einer Vielzahl von Untersuchungen zur sozialen Lage der Arbeiterschaft wurde um 1900 eine Datenbasis zur Lösung der sozialen Frage geschaffen. Marion Keller kann zeigen, dass Frauen dazu einen entscheidenden Beitrag geleistet haben – obwohl ihnen zu diesem Zeitpunkt der Zugang zu Universitäten noch weitgehend verwehrt und die Mitarbeit in politischen Vereinen und Parteien verboten war. Die empirischen Studien von Elisabeth Gnauck-Kühne, Gertrud Dyhrenfurth, Rosa Kempf und Marie Bernays waren aufwendig und methodisch innovativ. Sie vermittelten einen ersten Einblick in die bis dahin nicht erforschten prekären Lebens- und Arbeitsbedingungen von Fabrikarbeiterinnen, Heimarbeiterinnen und Frauen in der Landwirtschaft.
Keller verknüpft in dieser Arbeit Ansätze der Wissenschaftsgeschichte mit einer geschlechterhistorischen und wissenschaftssoziologischen Perspektive, um den Beitrag von Frauen zur empirischen Sozialforschung im Wilhelminischen Kaiserreich sichtbar zu machen. Sie beleuchtet, in welchen Kontexten und unter welchen Einflüssen die Forschungsarbeiten der Pionierinnen entstanden – und welche Rückwirkung ihre Studien auf Wissenschaft, Politik und Gesellschaft hatten.
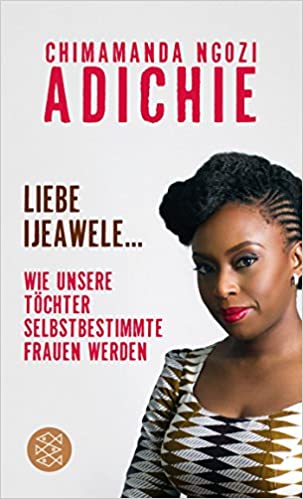
Liebe Ijeawele
Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Mit fünfzehn Vorschlägen für eine feministische Erziehung wirft die Bestseller-Autorin Chimamanda Ngozi Adichie so einfache wie wichtige Fragen auf und spannt den Bogen zwischen zwei Generationen von Frauen.
Chimamanda Ngozi Adichie, Feministin und Autorin des preisgekrönten Weltbestsellers ›Americanah‹, hat einen Brief an ihre Freundin Ijeawele geschrieben, die gerade ein Mädchen zur Welt gebracht hat. Ijeawele möchte ihre Tochter zu einer selbstbestimmten Frau erziehen, frei von überholten Rollenbildern und Vorurteilen. Alles selbstverständlich, aber wie gelingt das konkret?
Mit ihrem Manifest ›Liebe Ijeawele. Wie unsere Töchter selbstbestimmte Frauen werden‹ zeigt Chimamanda Adichie, dass Feminismus kein Reizwort ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Mit fünfzehn simplen Vorschlägen für eine feministische Erziehung öffnet sie auch den Blick auf die eigene Kindheit und Jugend. Die junge nigerianische Bestseller-Autorin steht für einen Feminismus, mit dem sich alle identifizieren können. Ein Buch für Eltern und Töchter.
We should all be feminists!
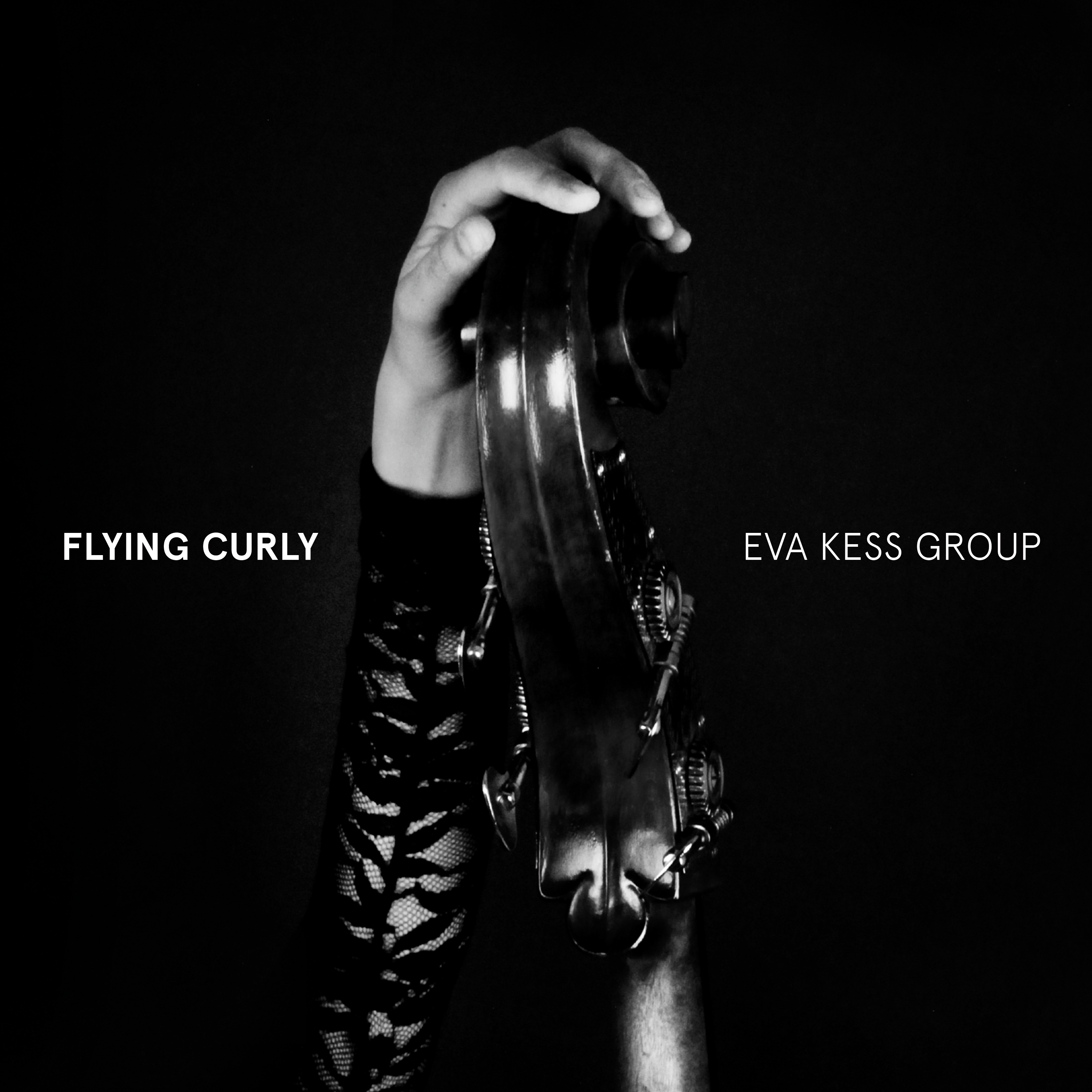
Flying Curly
Kesselring, Eva, Eva Kess Group, z. Bsp. Amazon 19,99 € (ASIN: B06WVMFXRW)
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Kontrabassistin und Komponistin Eva Kess veröffentlicht mit « Flying Curly » ihre zweite Eigenkompositions-CD. Ihre sensiblen und ausdrucksstarken Kompositionen verkörpern einen ganz eigenen Stil und immensen Stimmungsreichtum.
Zusammen mit ihren drei Mitmusikern Filipe Duarte (Gitarre), Gregor Fticar
(Piano) und Peter Kronreif (Drums) kreiert sie einen fantasievollen und poetischen musikalischen Mikrokosmos. Eva Kess startete ihre Karriere mit Steptanz in Porto Alegre und klassischem Klavier und Ballett in Bern. Jazz studierte sie an der Musikakademie der Stadt Basel bei Bänz Oester und Larry Grenadier.
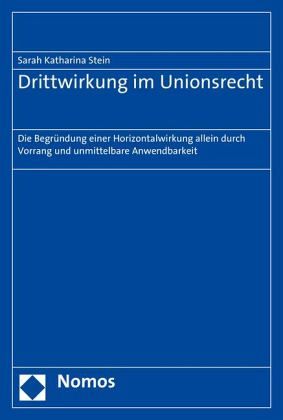
Drittwirkung im Unionsrecht
Die Begründung einer Horizontalwirkung allein durch Vorrang und unmittelbare Anwendbarkeit
Sarah Katharina Stein, Nomos Verlaggesellschaft 2016, S.151, 39€, ISBN 978-3-8487-3239-5
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Eine vom DAB geförderte Magisterarbeit. - Die Arbeit entwirft eine indigen europarechtliche Lösung zum Problem der unmittelbaren Drittwirkung von primärrechtlichen Normen. Das Phänomen der Wirkung von ursprünglich abwehrrechtlich verstandenen Normen zwischen Privaten stößt häufig auf Kritik, die aus einer Übertragung von nationalstaatlichen, dogmatischen Ansätzen und Sichtweisen auf die europäische Ebene stammen. Die Arbeit untersucht die Rechtsprechungslinien des EuGH zu Grundfreiheiten, allgemeinen Grundsätzen und den Gewährleistungen der Grundrechtecharta sowie den Wortlaut der fraglichen Normen und entwirft eine eigene Theorie, die auf das Konstrukt der Drittwirkung verzichtet. Eine Horizontalwirkung kann nach der hier dargestellten Theorie allein durch die vom EuGH entwickelten und anerkannten Konzepte "Vorrang" und "unmittelbare Anwendbarkeit" begründet werden, ohne dass es einen Rückgriff auf das Konzept der "Drittwirkung" bedarf.
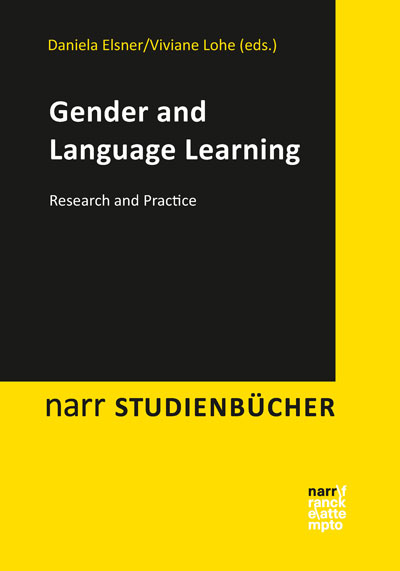
Gender and Language Learning
Research and Practice
Daniela Elsner/Viviane Lohe, narr Studienbücher, 2016, S. 240, 24,99€, ISBN 978-3-8233-6988-2
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Although Gender Studies have found their way into most domains of academic research and teaching, they are not directly in the spotlight of foreign language teaching pedagogy and research. However, teachers are confronted with gender issues in the language classroom everyday. By the use of language alone, they construct or deconstruct gender roles with the choice of topics they shape gender identities in the classroom and their ways of approaching pupils clearly mirrors their gender sensitivity. The book "Gender and Language Learning" aims at raising awareness towards gender issues in different areas of foreign language teaching and learning. The primary objective of the book is to spark university students', trainee teachers' and in-service teachers' analysis and reflection of gender relations in the foreign language learning and teaching section.
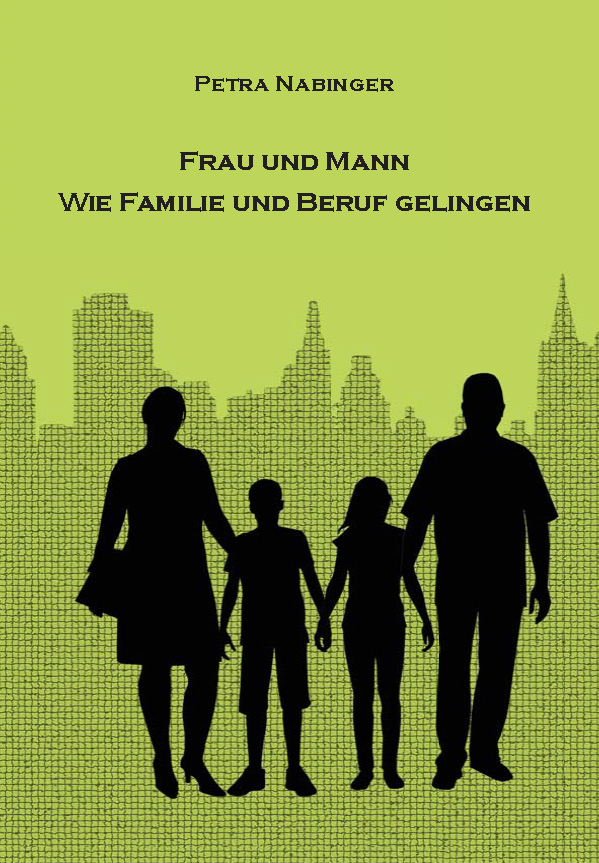
Frau und Mann - Wie Familie und Beruf gelingen
Petra Nabinger, LITTERA-Verlag, 2016, 145 Seiten, 15,90€, ISBN: 9783945734216
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In diesem Buch wird das Thema ´Chancengleichheit´ aus der Perspektive einer Betroffenen beleuchtet: Ich bin sowohl stolz darauf, vierfache Mutter zu sein, als auch stolz darauf, beruflich in einer Männerdomäne zu arbeiten. Dieses ermöglicht es mir, interessante Blickwinkel einzunehmen und festzustellen, dass wir nach wie vor noch weit entfernt sind von der Chancengleichheit. Sicherlich gibt es schon zahlreiche gute Entwicklungen, auch dank der Gesetzesinitiativen der vergangenen Jahre. Aber von einer ausgeglichenen Work-Family-Balance kann noch nicht gesprochen werden.
Ich hoffe daher, neben zahlreichen Leserinnen auch mutige Leser damit anzusprechen, denn das sind wichtige Unterstützer für Projekte zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Frauenförderung! Sie nehmen bei der Umsetzung eine entscheidende Rolle ein, denn das aktuelle Management ist immer noch in Männerhand. Also sind es insbesondere die Männer, die hier einiges bewegen können. Gesucht werden Entscheider, die den Mut haben, entgegen bisheriger Traditionen neue Wege zu gehen und dieses als Selbstverständnis in den Leitlinien und den Köpfen ihres Unternehmens zu manifestieren! Zur Verdeutlichung sind manche Themen mit einer Prise Humor angereichert, andere wiederum eher provokant formuliert. Doch lesen Sie selbst, was damit gemeint ist. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und Inspiration für Ihr weiteres Tun!
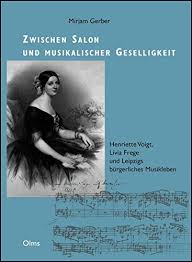
Zwischen Salon und musikalischer Geselligkeit
Henriette Voigt, Livia Frege und Leipzigs bürgerliches Musikleben
Mirjam Gerber, Georg Olms Verlag, 2016, S.404, 58€, ISBN 978-3-487-42177-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Das Phänomen des musikalischen Salons im 19. Jahrhundert wurde bislang oft idealisiert dargestellt. Die Analyse zeitgenössischer Quellen eröffnet einen neuen Blick auf die faszinierende private Musikpraxis der Musikmetropole Leipzig und ihrer Akteure. Am Beispiel der musikalisch professionell ausgebildeten Frauen Henriette Voigt und Livia Frege lernt der Leser die bedeutenden Netzwerke und anspruchsvollen Aufführungsmöglichkeiten kennen, die Bürgerhäuser für Komponisten und Interpreten boten. Mendelssohns Opernfragment „Loreley“, Schumanns „Faust-Szenen“ und Brahms’ Lieder kamen hier ebenso zur Aufführung wie Bachs h-moll-Messe oder Beethovens Kammermusik. Die musikalischen Geselligkeitsformen des 19. Jahrhunderts bilden einen spannenden Kristallisationspunkt des Bürgertums und seiner Musikästhetik. Die Entstehung eines Werkkanons, die Idee einer bildungsorientierten Bürgerlichkeit und die Entwicklung eines öffentlichen Konzertlebens stehen in enger Wechselbeziehung damit. Eine Materialsammlung zu privaten Musikaufführungen in Leipzig mit Repertoireaufstellungen sowie eine lexikalische Untersuchung weiterer Veranstalter vervollständigen die Studie.
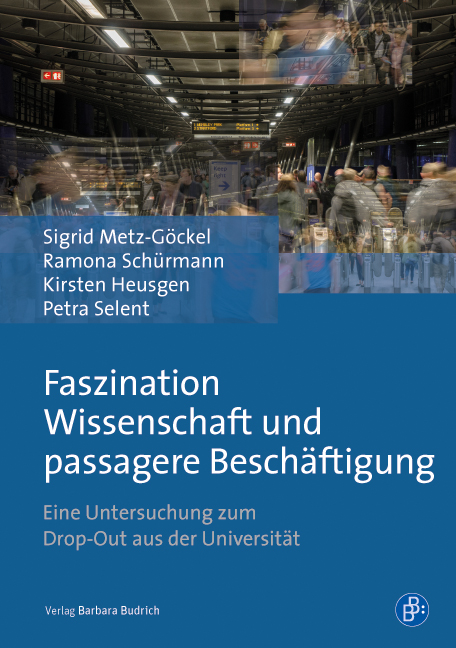
Faszination Wissenschaft und passagere Beschäftigung
Eine Untersuchung zum Drop-Out aus der Universität
Metz-Göckel, Sigrid/Schürmann, Ramona/Heusgen, Kirsten/Selent, Petra (Hrsg.), Barbara Budrich Verlag, 2016, 36,- €, ISBN 978-3-8474-0129-2
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Unstete Beschäftigungsverhältnisse, fragile Wissenschaftslaufbahnen, unberechenbare Berufsperspektiven – das deutsche Wissenschaftssystem ist durch ein Selektions- und Fluktuationsprinzip gekennzeichnet. Knapp ein Fünftel der wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen verließ 2009 die Universität nach im Durchschnitt 4,5 Jahren und 3,6 gestückelten Verträgen. Diese personelle Fluktuation beschreiben die Autorinnen mit der Metapher der Reisenden, die eine Zeit lang im wissenschaftlichen Zugsystem mitfahren und an unterschiedlichen Stationen aussteigen. Ein kleiner Teil steigt wieder ein und führt die Reise fort. Anhand der Personaldaten von 18 Universitäten werden die Vertragsbiografien und Ausstiegsgründe dieser Drop-Outs rekonstruiert und mit einer Online-Befragung und Interviews ihr weiterer Verlauf und ihre Mobilität erforscht. Im Fokus stehen dabei die Promotions- und Post-Doc-Phase im internationalen Vergleich, die ungleichen Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Karriere von habilitierten Frauen und Männern sowie die Ressourcen- und Beanspruchungssituation von promovierten Uni-Beschäftigten bzw. Drop-Outs. In dem Sammelband (der die zentralen Ergebnisse des Forschungsprojekts »Mobile Drop-Outs« beinhaltet) werden unter Berücksichtigung der Geschlechter- und Fächerperspektive die aktuelle Beschäftigungssituation des wissenschaftlichen Nachwuchses und erstmalig Daten zu dem Wissenschafts-Drop-Out vorgestellt. Anhand eines »Hypothetischen Modells zur Analyse von Mobilitätsentscheidungen« wird dargestellt, welche Faktoren Mobilitätsentscheidungen und Karrierewege von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern bedingen. Es wird ausgeführt, welche Karrieremotivationen zu Beginn einer Beschäftigung an der Universität bestanden und ob und wie diese sich im Laufe der Beschäftigung veränderten. Es wird gefragt, welche Bedingungen für das Erreichen bzw. Nicht-Erreichen des Karriereziels ausschlaggebend waren. Des Weiteren wird dargestellt, wie die Entscheidungsprozesse „Bleiben oder gehen?“ (Stichwort: Cooling-Out) verlaufen. Welche Faktoren beeinflussen diesen Prozess? Welche Entscheidungsstrategien kommen zum Tragen und welche Rolle spielt das private bzw. akademische Umfeld? Lassen sich Kriterien definieren, die ein erfolgreiches Verbleiben in der Wissenschaft ermöglichen? Der Promotionsphase und der Post-Doc-Phase wird mit einem internationalen Vergleich ein weiterer Schwerpunkt gewidmet. Darüber hinaus werden die ungleichen Voraussetzungen für eine wissenschaftliche Karriere bei Frauen und Männer am Beispiel habilitierter Wissenschaftler/innen thematisiert. Die Ressourcen- und Beanspruchungssituation von wissenschaftlich Beschäftigten wird in einem weiteren Kapitel in den Blick genommen. Ein Beitrag zum betrieblichen Gesundheitsmanagement an Universitäten rundet dieses Thema ab.
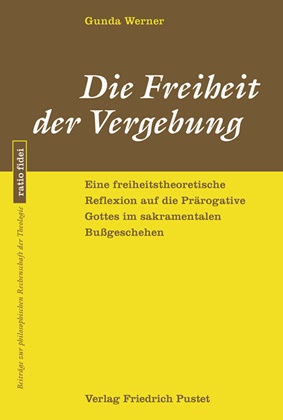
Die Freiheit der Vergebung
Eine freiheitstheoretische Reflexion auf die Prärogative Gottes im sakramentalen Bußgeschehen
Gunda Werner, Pustet Verlag 2016, 387 Seiten, 44 €, ISBN-10: 3791727796, ISBN-13: 9783791727790
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Auch in säkularen Gesellschaften verschwindet das humane Bedürfnis nach Vergebung und Versöhnung nicht. Allerdings findet es andere Ausdrucksformen als die katholische Einzelbeichte. Wie kommt es zu dieser Verschiebung? Was lässt sich aus den außertheologischen Vergebungsdiskursen für die theologische Fragestellung gewinnen? Wie ist die Vergebung Gottes im Sakrament der Buße zu verstehen? Ziele dieser Arbeit sind erstens eine theologische Theorie der Vergebung, die sich in den soziokulturellen Kontext eines säkularen Staates und eines postmodernen Lebens hinein vermitteln lässt; zweitens eine dogmatische Begründung des Sakraments der Beichte im Kontext einer pneumatologischen Ekklesiologie. Eine umfangreiche dogmengeschichtliche Aufarbeitung des Bußsakraments in der Neuzeit und eine kritische Hermeneutik sowohl des Konzils von Trient als auch des II. Vatikanums liefern dafür die Basis.Gunda Werner, Dr. theol., geb. 1971, ist Juniorprofessorin für Dogmatik und Leiterin der Abteilung Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Tübingen. Sie wurde 2005 in Münster zum Dr. Theol promoviert und im Wintersemester 2015/2016 mit der vorliegenden Arbeit als erste Frau an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Uni Bochum habilitiert.
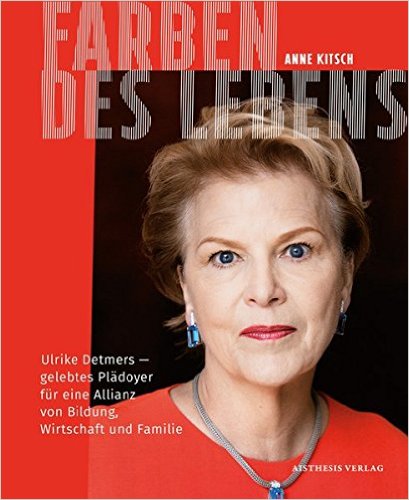
Farben des Lebens:
Ulrike Detmers - gelebtes Plädoyer für eine Allianz von Bildung, Wirtschaft und Familie
Anne Kitsch, Aisthesis Verlag, 2016, 144 Seiten, 19,80 €, ISBN 978-3849812003
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Familienunternehmerin und Professorin Ulrike Detmers ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit: Sie hat Visionen und Mut, sorgt mit einem höchst innovativen Marketingkonzept für die Alleinstellung des mittelständischen Unternehmens Mestemacher, ist eine umtriebige Netzwerkerin und sie kämpft neben alldem überaus wirkungsvoll für die Gleichstellung von Mann und Frau und für Arbeitsverhältnisse, die es ermöglichen, Familie und Beruf zu verbinden. In ihrem Tun und Machen steckt eine faszinierende Gleichzeitigkeit, stets ist sie absprungbereit zur nächsten Aktion. Die Autorin Anne Kitsch bleibt ihr auf den Fersen: gesucht, gefunden und gemeinsam kurz innegehalten für diese Biografie, die alle Facetten von Ulrike Detmers beleuchtet: Ehefrau, Mutter, Unternehmerin, Hochschullehrerin, Mäzenin und Stifterin so wichtiger Preise wie dem der ›Managerin des Jahres‹. Ein Leben voller Farben und Schattierungen – gleichermaßen der Bildung, der Wirtschaft und der Familie gewidmet.

UnWohlgefühle
Eine Kulturanalyse gegenwärtiger Befindlichkeiten
Elisabeth Mixa, Sarah Miriam Pritz, Monica Greco, transcript Verlag, 2016, S.267, 29,99€, ISBN 978-3-8376-2630-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Gegenwärtige westliche Gesellschaften sind von einem Paradoxon gekennzeichnet: Einem gesellschaftlichen Imperativ auf Wohlgefühle korrespondiert eine alarmierende Zunahme an psychischen Leidenszuständen. Burnout, Angstzustände, Depressionen- auch Selbstwahrnehmungen basieren zusehends auf einem therapeutischen Blick.International renommierte Wissenschaftler_innen, darunter Christina von Braun, Monica Greco, August Ruhs und Paul Stenner, gehen in diesem Buch aus transdisziplinärer Perspektive der Frage nach, wie diese Entwicklungen analysiert und erklärbar gemacht werden können.

religion@home? Religionsbezogene Online-Plattformen und ihre Nutzung
Eine Untersuchung zu neuen Formen gegenwärtiger Religiosität
Anna Neumaier, ergon Verlag 2016, S.478, 58€, ISBN 978-3-95650-141-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Über den Wandel gegenwärtiger Religion und Religiosität ist in Debatten rund um Säkularisierung und Re-Sakralisierung viel diskutiert worden. Die Bedeutung neuer Medien wurde dabei aber noch wenig berücksichtigt. An diese Debatten anschließend widmet sich die vorliegende Studie deshalb religiöser Online-Nutzung, ihren Bedingungen, Formen und Konsequenzen: Was sind Auslöser für den Einstieg, Themen des Online-Austauschs, und in welchem Zusammenhang steht die Online-Nutzung mit der Einbettung in die lokale Gemeinde?Dem geht die Arbeit mit Blick auf christliche Online-Foren nach. Sie beschränkt sich dabei nicht auf Analysen der Online-Diskussionen, sondern stellt mit über 30 qualitativen Interviews und einer quantitativen Erhebung die Perspektive der Nutzer dieser Foren in den Mittelpunkt.Insgesamt zeigt sich: Forennutzung ist vor allem als Strategie der Restabilisierung individueller Religiosität zu verstehen. Ihr Ausgangspunkt sind weniger mediale Eigenschaften des Internets, sondern vielmehr Defizite traditioneller religiöser Angebote, die zu anhaltender Unzufriedenheit oder dem Abbruch der Gemeindeeinbettung führen. Durch die Aneignung individueller religiöser Expertise und Wiedereinbettung in einen Kontext kollektiver Legitimierung von Religiosität vermag die Online-Nutzung hier Ausgleich zu schaffen. Die erarbeiteten Nutzungsmuster und Typen online entstehender Gemeinschaften zeigen Details dieser Prozesse.
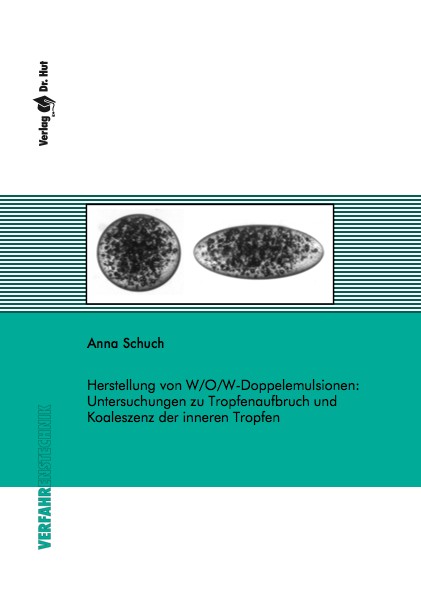
Herstellung von W/O/W-Doppelemulsionen
Untersuchungen zu Tropfenaufbruch und Koaleszenz der inneren Tropfen
Anna Schuch, Verlag Dr. Hut, 2015, S. 214, 45,00€, ISBN 978-3-8439-1647-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
W1/O/W2-Doppelemulsionen besitzen aufgrund ihrer mehrphasigen Struktur Potential für Anwendung in verschiedenen Industriebereichen z.B. zur Verkapselung von Stoffen oder zur Fettreduktion in Lebensmitteln. Die Herstellung dieser Strukturen stellt jedoch noch immer eine große Herausforderung dar.Ziel dieser Arbeit war es deshalb zum einen, den Aufbruch von Doppelemulsionstropfen in verschiedenen Strömungen zu untersuchen und zu beschreiben. Andererseits wurden die während oder direkt nach der Herstellung auftretenden Instabilitäten, die die Struktur der Doppelemulsionen verändern und damit auch deren Funktionalität beeinflussen, untersucht. Mithilfe des grundlegenden Verständnisses der Instabilitätsmechanismen soll es langfristig möglich sein, stabile Doppelemulsionen herzustellen.

Marie Munk (1885-1978): Leben und Werk
Oda Cordes, Böhlau Köln Verlag, 2015, S. 987, 110 €, ISBN 978-3-412-22455-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Marie Munk, eine der ersten Juristinnen Deutschlands, war wegweisend für die Selbstbestimmung der Frau im Eherecht und für die Zugewinngemeinschaft im heutigen Ehegüterrecht. Zudem trat sie für ein gemeinsames Sorgerecht der Kinder nicht miteinander verheirateter Eltern bereits in Weimarer Zeit ein. Nach ihrer Emigration in die USA profilierte sie ihr juristisches Werk in der amerikanischen Uniform Law Bewegung, in der Justizausbildungs- und Gerichtsstrukturreform. Das Buch beschreibt Leben und Werk der Marie Munk und arbeitet sie als Wegbereiterin einer Diversität in der Wissenschaft heraus.Vorab:Warum interessiert Marie Munk?
Sie war eine der ersten preußischen Juristinnen (Promotion 1911), Mitbegründerin des Dt. Juristinnen Vereins 1914, des Dt. Akademikerinnenbundes 1926 und Gründerin des BPW (Business and Professional Women) 1931!
Oda Cordes legt in ihrem Buch keine einfache Biographie über Marie Munk vor, sondern es ist eine rechtshistorische, vergleichende Arbeit. Den Schwerpunkt ihrer Ausführungen hat sie auf den Einfluss gelegt, den vor allem die Publikationen Marie Munks auf die rechtspolitischen Entwicklungen in allen Bereichen des Familienrechts sowohl in Deutschland wie auch in den USA hatten.
Neben den biographischen Daten geht sie umfänglich auf die Inhalte der vielzähligen Publikationen von Marie Munk ein. Dabei spielt auch der Austausch von Gedanken, den Marie Munk schon im Entstehungsprozess ihrer Veröffentlichungen vor allem mit anderen Juristinnen und Juristen in Deutschland und den USA pflegte.
Oda Cordes stellt zuerst einmal den Bildungs- und Werdegang von Marie Munk im Kontext ihrer Familie und der Zeit dar, wobei eine frühentwickelte starke Persönlichkeit mit ausgeprägten analytischen, intellektuellen Fähigkeiten deutlich wird. Ihr Elternhaus entsprach nicht dem bürgerlichen Durchschnitt jener Zeit. Der Vater, ein Jurist, entstammte einer christianisierten jüdischen Berliner Familie. Er war - entsprechend jüdischer Tradition - für eine gute Ausbildung der Töchter offen. Die Mutter, aus Pommern stammend, machte vor der Ehe eine Ausbildung zur Restauratorin, was für die 70er Jahre des 19. Jahrhunderts für eine Frau unüblich war. Es bestand also von keiner Elternseite ein Vorbehalt gegen die Bildung der beiden Töchter, von denen die ältere, Gertrud (geb. 1880), Künstlerin wurde. Die jüngere, Marie (geb. 1885), machte nach dem Besuch der höheren Töchterschule eine nach eigenen Aussagen mäßig erfolgreiche Ausbildung als Kindergärtnerin, wofür ihr die manuellen Fähigkeiten beim Basteln fehlten. Eine anschließende Tätigkeit in sozialer Hilfsarbeit, die ihr zwar viele Einblicke in soziale Missstände gab, machte ihr noch deutlicher, dass das nicht ihr Weg sein konnte. Über Vorbereitungskurse für Mädchen konnte sie 1907 das Abitur an einem Jungengymnasium machen und Jura, wie ihr Vater studieren. Der ältere Bruder, Ernst (geb. 1883), auch Jurist, fiel im ersten Weltkrieg.
Marie Munk war eine der ersten Jurastudentinnen in Preußen, das ja bekanntlich als letztes der deutschen Länder erst 1908 Frauen allgemein zum Studium zuließ. Vorher bedurfte es einer ministeriellen Sondergenehmigung, um als Frau studieren zu können. Ein juristisches Staatsexamen oder gar ein zweites Staatsexamen, was zum Richterberuf berechtigt hätte, war für Frauen in Preußen erst in der Weimarer Republik möglich. So schloss Marie Munk ihr Jurastudium 1911 mit einer Dissertation ab. Ihre beruflichen Möglichkeiten waren aber sehr eingeschränkt, sowohl als Frau als auch als Juristin.
Ihre erste Ausbildung in einem Sozialberuf hatte ihr Augenmerk schon früh auf Familienprobleme geleitet. So verschrieb sie sich zeitlebens dem gesamten Bereich des Familienrechts, also auch dem Eherecht, dem Erbschaftsrecht, dem Ehegüterrecht, dem Scheidungs- und Scheidungsfolgenrecht sowie dem Nichtehelichenrecht. Sehr intellektuell ausgerichtet, entschied sie sich schon früh gegen eine eigene Familie, da sie nicht sah, wie sie ihre wissenschaftlichen Interessen in Einklang mit Familienpflichten bringen könnte. – Ihre Mutter hatte ja ihre eigenen beruflichen Träume mit der Familiengründung an den Nagel gehängt.
Da ihr als Frau, der Zeit entsprechend, der normale Berufsweg einer Juristin verwehrt war, prägte ihren beruflichen Werdegang eine prekäre Beschäftigung nach der anderen, wie man heute sagen würde. Ohne die finanzielle Unterstützung ihrer Familie im Hintergrund, wäre ihre wissenschaftliche Tätigkeit kaum denkbar gewesen. Als sie endlich mit mehr als 40 Jahren und wie Oda Cordes ausführlich darstellt, nur mit Hilfe ihrer guten Beziehungen als Richterin Fuß fassen konnte und erstmals ein festes Einkommen besaß, war dies nur von kurzer Dauer, da mit der Machtergreifung Hitlers alle Frauen aus den juristischen Berufen entfernt wurden. Bei Marie Munk spielte dann auch noch zusätzlich ihre jüdische Abstammung eine negative Rolle, so dass sie 1936 in die USA emigrierte, die sie 1933/34 bereits intensiv auf einer Studienreise kennengelernt hatte.
Auch dort waren ihre Lebensumstände meist prekär. Erst deutlich nach dem 2. Weltkrieg (1956) konnte sie von der Berliner Justizverwaltung eine Rente als Oberregierungsrätin rückwirkend seit ihrer Entfernung aus dem staatlichen Dienst erstreiten, was sie im Alter von 70 Jahren erstmals in ihrem Leben von Finanzsorgen entlastete. Oda Cordes zeigt sehr ausführlich, wie mühsam dieser Weg zur Rente für Opfer des Nationalsozialismus wie Marie Munk war. Dies galt aber auch für viele ähnlich gelagerte Fälle.
Nach dem Krieg wurde ihr die Rückkehr in den deutschen Justizdienst angeboten und Ende 1949 noch einmal durch einen Bekannten aus der Weimarer Republik konkret eine Stelle, obwohl schon im Rentenalter, im Bundesjustizministerium in Bonn mit der Aufgabe, ein neues Familienrecht mitzugestalten. Sie lehnte aber ab, da sie hierfür ihre amerikanische Staatsbürgerschaft hätte aufgeben müssen.
Oda Cordes geht immer wieder auf die Netzwerke ein, die sich Marie Munk geschaffen hatte und die ihr Überleben in schwierigen Zeiten erleichterten. Eine besondere Rolle spielte für sie in ihrer frühen Zeit der von ihr 1914 mitgegründete Deutsche Juristinnen Verein, der Vorläufer des heutigen Deutschen Juristinnen Bundes, über den sie Mitglied im Bund Deutscher Frauenvereine war. Bei diesem leitete sie die Kommission zur Reform des Familienrechts, das große Thema ihres Lebens. Hierdurch wurde es ihr auch möglich auf dem 33. Juristentag 1924 in Heidelberg ihre Vorstellungen einer großen Fachöffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen und dadurch weitere persönliche Kontakte auch in die männliche Juristenwelt zu knüpfen.
In ihrem späteren Leben, vor allem nach der Emigration in die USA, war für sie der BPW (Business und Professional Women), dessen deutschen Zweig sie 1931 gegründet hatte, besonders hilfreich. Über diesen hatte sie schon 1933 ihre erste Amerika-Reise organisieren können. In späteren Jahren konnte sie durch Vermittlung des amerikanischen BPW in großem Umfang ihren Lebensunterhalt sichern, sei es durch Vorträge oder aber durch Kontakte, die sie in Jobs weitervermittelten.
Durch ihre dortigen Jobs kam sie noch intensiver mit sozialen Fragen in Berührung als vorher schon in Deutschland. In ihren in Amerika entstandenen Manuskripten kam ein intensiver sozialwissenschaftlicher Ansatz in ihre juristische Argumentation. Das zeigt sich z.B. in ihren Manuskripten zur Resozialisierung im Strafvollzug und zwar sowohl der Resozialisierung des erwachsenen Straftäters als auch der Forderung nach Strafaussetzung für Jugendliche, die erst in den Gefängnissen zu Verbrechern würden. Auch dies waren Ansätze, mit denen sie ihrer Zeit weit voraus war.
Sie sprach auch immer wieder die starke Zersplitterung des Familienrechts in den USA als unglücklich an. Nicht nur dass jeder Bundesstaat sein eigenes Familienrecht hatte, sondern auch die Rechtssystematik variierte stark von Staat zu Staat, je nachdem ob der Staat als Folge seiner Gründungsgeschichte unter dem Einfluss des britischen oder des französischen Rechts stand.
Eine Vielzahl ihrer umfangreichen Abhandlungen, die sie in den USA verfasste, wurden aber nicht veröffentlicht, wie Oda Cordes nachweist. Durch ihren regen Gedankenaustausch mit anderen Wissenschaftlern in den USA fanden ihre konstruktiven Gedankengänge trotzdem auch Eingang in die amerikanische juristische Diskussion.
Oda Cordes stellt in ihrem Buch vor allem auf den Einfluss ab, den die zahlreichen schriftlichen Ausführungen von Marie Munk auf die juristischen Diskussionen im gesamten Familienrecht von etwa 1920 bis in die Jetztzeit hatten. Sie war in allen Bereichen mit ihren Ansichten weit ihrer Zeit voraus. Als Beispiel sei ihre argumentativ fundierte Ablehnung des Schuldprinzips im Ehescheidungsrecht genannt oder auch Fragen der Zugewinngemeinschaft und der Gütertrennung im Eherecht.
Für ihren anhaltenden Einfluss spielte die gute Vernetzung in die juristische Fachwelt eine herausragende Rolle. Auch ihre nicht veröffentlichten Werke hatte sie im Entstehungsprozess mit Fachkollegen diskutiert, wie Oda Cordes darlegt. Diese übernahmen Marie Munks Gedankengänge nicht selten in ihre eigenen, später veröffentlichten Werke.
Dass Marie Munks Name heute weitgehend vergessen ist, hängt auch damit zusammen, dass sie nach dem 2. Weltkrieg nur zu wenigen Studienreisen nach Deutschland und Europa zurückkehrte. Sie war nicht, wie andere Frauen der Weimarer Zeit, z.B. Marie-Elisabeth Lüders, Elisabeth Selbert oder Elisabeth Schwarzhaupt im Prozess des Demokratieaufbaus in Deutschland involviert. Auch waren ihre Kontakte zu Juristen aus der Weimarer Republik vor allem auf Berlin konzentriert gewesen, das in der Bonner Republik keine führende Rolle mehr spielte und nicht wenige ihrer Kontakte gingen zu Juristen, die sich in der sowjetischen Besatzungszone und dann in der DDR weiter betätigten.
Die 750 Seiten lange Arbeit ist durch ihre starke Verquickung von Textpassagen aus Marie Munks Manuskripten mit anderen zeitgenössischen Strömungen nicht flüssig zu lesen. Oft sind diese wörtlichen Textpassagen – meist auf Englisch – aber nur zur weiteren Untermauerung des Denkansatzes von Marie Munk herangezogen. Diese Texte, wenn sie denn überhaupt zur Demonstration herangezogen werden sollen, wären besser in den Fußnoten aufgehoben, die an sich schon sehr umfangreich sind. Etwas mehr Stringenz in der Gliederung wäre für die Adaption der Arbeit durch den Leser ebenfalls von Vorteil. So besteht die Gefahr, dass das sehr informative aber auch sehr teure Buch (€ 110,--) etwas für die Universitätsbibliotheken ist, falls diese es sich überhaupt leisten können, aber weniger für ein breites an der Rolle von Frauen in Wissenschaft und Gesellschaft im Allgemeinen interessiertes Publikum.
Es ist jedoch das uneingeschränkte Verdienst von Oda Cordes, das gesamte Lebenswerk von Marie Munk bibliographisch erfasst zu haben. Sie stellt zudem eine Vielzahl der Manuskripte der Öffentlichkeit – auch online über den Verlag – zur Verfügung, die sie in den Archiven in Deutschland und den USA einsehen konnte. Das erleichtert weitere Arbeiten über das Schaffen von Marie Munk.
Sie hat Marie Munk als eine Frau wieder in unser Bewusstsein gebracht, die die Familiengesetzgebung in Deutschland durch ihren persönlichen Einsatz und ihre Publikationen maßgeblich mitgeprägt hat.
Dafür gebührt ihr Dank. Dr. Vera Gemmecke-Kaltefleiter, DAB Gruppe Kiel
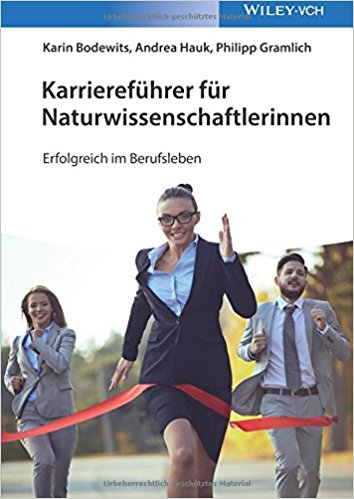
Karriereführer für Naturwissenschaftlerinnen
Erfolgreich im Berufsleben
Karin Bodewitz (Autor), Andrea Hauk (Autor), Philipp Gramlich (Autor) ab 29,90 €, ISBN 978-3-5276-8782-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In Deutschland schließen inzwischen ebenso viele Frauen wie Männer ein naturwissenschaftliches Studium ab. Welche Karrieremöglichkeiten stehen ihnen offen? Wie begegnen sie der sehr realen Gefahr der Altersarmut durch Stipendien und befristete Anstellung? Und wie schaffen sie es, Familie und Beruf miteinander zu vereinbaren? Karin Bodewits, Andrea Hauk und Philipp Gramlich zeigen in diesem etwas anderen Karriereführer, wie Naturwissenschaftlerinnen die Widrigkeiten des Berufseinstiegs meistern und schon während des Studiums die Weichen richtig stellen können, um im Berufsleben zu bestehen. Die Autoren schöpfen dabei nicht nur aus ihren persönlichen Erfahrungen mit der Arbeitswelt, sondern lassen zahlreiche Wissenschaftlerinnen zu Wort kommen, die ihre mehr oder weniger geradlinigen Karrierewege schildern. Frauen aber auch Männer finden hier viele wertvolle Karrieretipps, von Alternativen zur klassischen Forscherkarriere über die richtige Bewerbung, Aufstiegsmöglichkeiten und beruflichen Wechsel bis zum Wiedereinstieg nach einer Familienpause. Sein lockerer und humorvoller Stil macht das Buch zu einem sympathischen Begleiter durch das Berufsleben, den man beziehungsweise frau nicht mehr missen möchte!
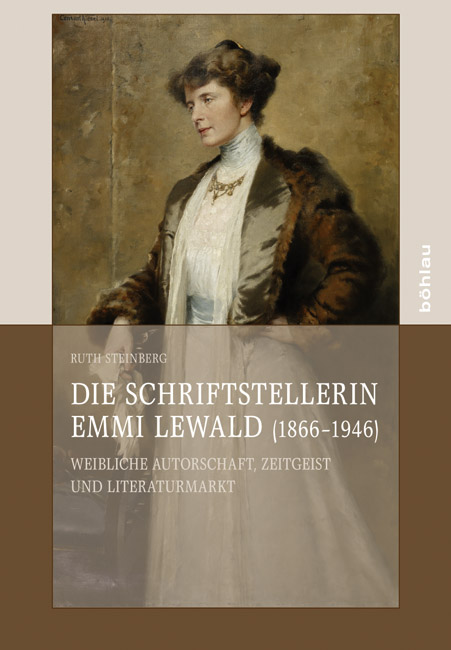
Die Schriftstellerin Emmi Lewald (1866 - 1946)
Weibliche Autorschaft, Zeitgeist und Literaturmarkt
Ruth Steinberg-Groenhof, Böhlau Verlag, 2015, S. 507, 69,90€, ISBN 978-3-4122-1788-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die 1866 geborene Emmi Lewald gehört zu den fast vergessenen Autorinnen des Deutschen Kaiserreichs und der Weimarer Republik. Ihr Interesse galt unterschiedlichen Aspekten der gesellschaftlichen Umbruchsituation um 1900, insbesondere der Alltagsrealität bürgerlicher Frauen und der im Kaiserreich intensiv diskutierten "Frauenfrage". Die Studie untersucht die sozialhistorischen Bedingungen, das Selbstverständnis, die Berufswirklichkeit und die Werke einer bürgerlichen Berufsschriftstellerin, deren Schreiben von der Orientierung am Literaturmarkt, von persönlichen künstlerischen Ambitionen und von den neuen Literaturströmungen der Zeit ebenso bestimmt wurde wie vom Wunsch, den historischen Wandel der Frauenrolle literarisch zu verarbeiten.
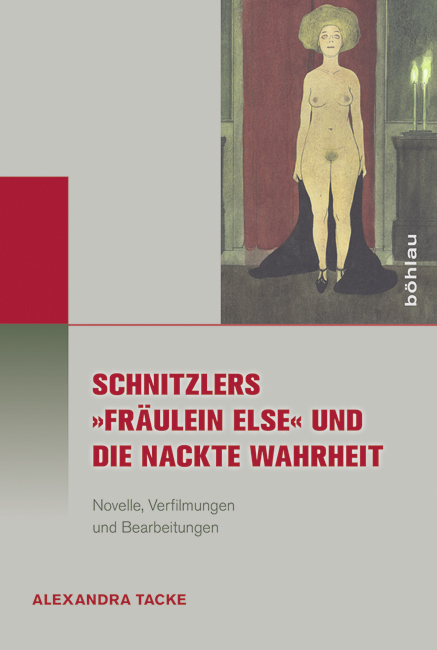
Schnitzlers "Fräulein Else" und die Nackte Wahrheit
Novelle, Verfilmungen und Bearbeitungen
Alexandra Tacke, Böhlau Verlag, 2015, S. 184, 29,90€, ISBN 978-3-4122-2497-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Im Zentrum von Arthur Schnitzlers Novelle "Fräulein Else" (1924) steht ein Skandal: Eine junge Frau entkleidet sich öffentlich im Musiksalon eines Hotels. Mit der Nacktszene greift Schnitzler ein Motiv auf, das um die Jahrhundertwende zu einem zentralen Thema avanciert und allseits präsent ist. Enthüllt wird dabei weniger der weibliche Körper als die "Nackte Wahrheit". Schnitzler geht es vor allem um ein Spiel mit der Sprachlosigkeit sowie der schamlosen Enthüllung der (Sprach-)Zeichen. Die zahlreichen Adaptionen und Bearbeitungen in Film, Fernsehen, Hörfunk, Bildender Kunst, Internet und Comic kreisen ebenfalls um diese Darstellungsproblematik, wie die Studie in ausführlichen Einzelanalysen erstmals zeigt.
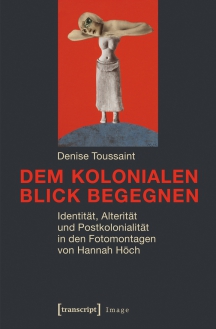
Dem kolonialen Blick begegnen
Identität, Alterität und Postkolonialität in den Fotomontagen von Hannah Höch
Denise Toussaint, transcript Verlag, 2015, S. 300, 36,99€, ISBN 978-3-8376-2874-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Zwischen 1922 und 1931 schafft die Berliner Künstlerin Hannah Höch eine große Reihe an Fotomontagen, in denen sie sich mit der Repräsentation und Rezeption des Fremden im frühen 20. Jahrhundert auseinandersetzt. In ihren Arbeiten formuliert Höch nicht nur ein kritisches Statement zum Primitivismus und zu den westlich-hegemonialen Sichtweisen ihrer Zeitgenossen, sondern stellt auch eine geradezu postkoloniale Forderung nach einer transkulturellen, globalen Kunst auf. Denise Toussaints ausführliche Betrachtung und Neuinterpretation von Höchs Werken im Lichte postkolonialer Theoriebildung fügt der Wahrnehmung der Dadaistin eine bedeutende Facette hinzu und platziert sie in einem international hochaktuellen Forschungsfeld.
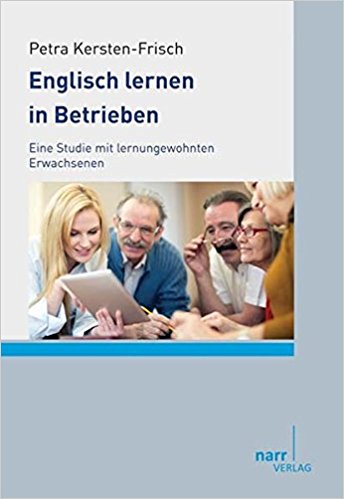
Englisch lernen in Betrieben
Petra Kersten-Frisch, Narr Francke Attempto Verlag, 2015, 208 Seiten, 68,00€, ISBN 978-3-8233-6978-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Englisch gehört heute zu den Schlüsselqualifikationen aller Beschäftigten in Betrieben. Auf der Basis einer umfangreichen Studie beantwortet dieser Band aus dem Englischunterricht mit Erwachsenen entstehende Fragen. Er bietet eine wissenschaftlich begründete Handlungsgrundlage und gibt zahlreiche praktische Tipps für den Unterricht, die auch auf andere Lernkontexte und Sprachen übertragbar sind. Das Buch ist gedacht als Anregung für einen nachhaltigen Fremdsprachenunterricht, der Freude am Lernen vermittelt. Es richtet sich an Lehrende in der Erwachsenenbildung,
ist aber auch interessant für Weiterbildungsabteilungen und Lehrkräfte, die in Schule und Ausbildung tätig sind.
Die Autorin ist Diplom-Übersetzerin für Englisch und Französisch. Sie arbeitete in verschiedenen Positionen in Unternehmen und unterrichtet seit vielen Jahren Englisch in der betrieblichen Weiterbildung und in Bildungsinstitutionen. 2013 promovierte sie im Fachgebiet Englischdidaktik. 2015 erhielt sie für ihre Arbeit den Deutschen Weiterbildungspreis.
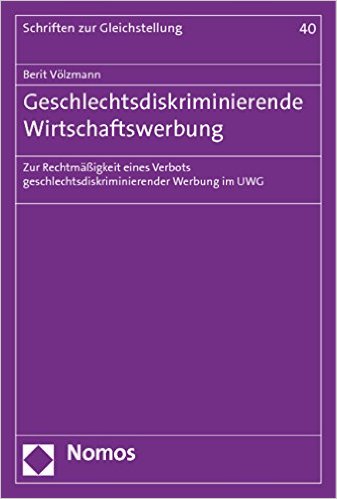
Geschlechtsdiskriminierende Wirtschaftswerbung
Zur Rechtmäßigkeit eines Verbots geschlechtsdiskriminierender Werbung im UWG
Berit Völzmann, Nomos Verlag, 2015, S. 327, 79,00€, ISBN 978-3-8487-1849-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Autorin unterzieht die Problematik geschlechtsdiskriminierender Werbung einer umfassenden rechtlichen Analyse. Sie geht neben der Wirksamkeit der Werbeselbstkontrolle vor allem auf das Verfassungsrecht ein, überträgt die Ergebnisse in das Lauterkeitsrecht und schlägt eine Verbotsnorm im UWG vor.
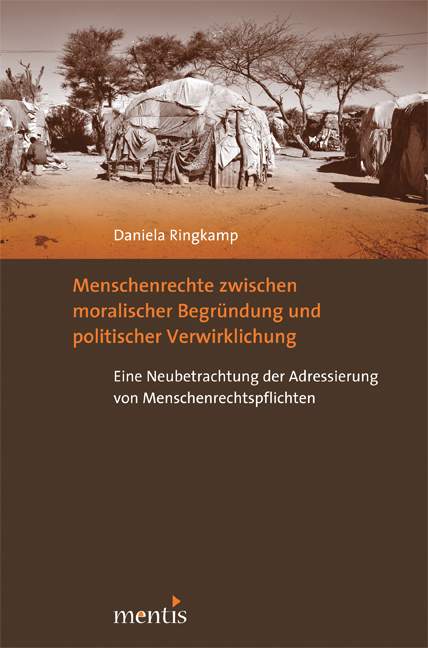
Menschenrechte zwischen moralischer Begründung und politischer Verwirklichung
Eine Neubetrachtung der Adressierung von Menschenrechtspflichten
Daniela Ringkamp, mentis Verlag, 2015, S. 257, 42€, ISBN 978-3-8978-5846-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Daniela Ringkamp geht in ihrer Studie auf den schon nachgerade als klassisch zu bezeichnenden Umstand ein, dass zwischen der moralischen Begründung und der tatsächlichen Implementierung von Menschenrechten global betrachtet eine große Lücke klafft. Für die Um‑ und Durchsetzung von Menschenrechten sind – darin bezieht sich die Autorin auf das institutionelle Verständnis von Menschrechten nach Thomas Pogge – die Staaten und ihre Institutionen verantwortlich. Menschenrechtsverletzungen verweisen demzufolge immer auf ein institutionelles staatliches Versagen. Das allerdings sei, so Ringkamps Kritik, zu eindimensional gedacht: „Die vorliegende Arbeit wird die von Pogge betonte ausschließliche Adressierung von Menschenrechtsansprüchen an Institutionen in Frage stellen [...]. Stattdessen argumentiert sie dafür, in bestimmter Hinsicht auch einzelne Individuen ohne Bezug zu öffentlichen Institutionen als Adressaten von Menschenrechtsansprüchen zu verstehen.“
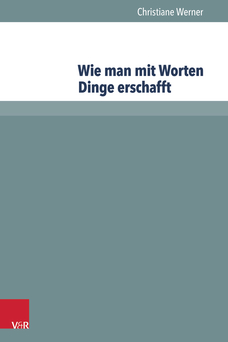
Wie man mit Worten Dinge erschafft
Die sprachliche Konstruktion fiktiver Gegenstände
Christiane Werner, V&R unipress, 2015, S. 260, 44,90€, ISBN 978-3-8471-0391-2
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die zentrale Fragestellung von »Wie man mit Worten Dinge erschafft« lautet: Wie können fiktionale Äußerungen, wie z.B. das Schreiben eines Romans, beschrieben werden? Es wird dafür argumentiert, dass auch diese sprachlichen Handlungen mit den Mitteln der Sprechakttheorie als Vollzüge sog. illokutionärer Akte beschrieben werden können. Weiter wird die These vertreten, dass Autoren mit diesen Äußerungen fiktive Charaktere erschaffen, die als besondere, nämlich nicht-räumliche Artefakte verstanden werden. Davon ausgehend kann bestimmt werden, dass fiktionale Äußerungen illokutionäre Akte vom Typ der Deklaration sind. Schließlich wird eine Analyse der Teilakte fiktionaler Äußerungen, d.h. der Bezugnahme und Prädikation vorgelegt.
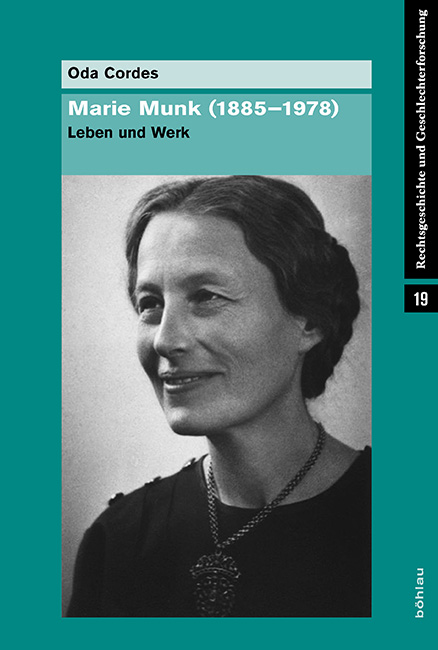
Marie Munk (1885–1978)
Leben und Werk
Oda Cordes, Böhlau Verlag, 2015, S. 990, 109€, ISBN 978-3-4122-2455-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Marie Munk, eine der ersten Juristinnen Deutschlands, war wegweisend für die Selbstbestimmung der Frau im Eherecht und für die Zugewinngemeinschaft im heutigen Ehegüterrecht. Marie Munk kann als die Erste bezeichnet werden, die das Zerrüttungsprinzip im Scheidungsrecht in Deutschland forderte. Sie trat für ein gemeinsames Sorgerecht der Kinder nicht miteinander verheirateter Eltern bereits in Weimarer Zeit ein. Nach ihrer Emigration in die U.S.A. profilierte sie ihr juristisches Werk in der amerikanischen Uniform Law Bewegung, in der Justizausbildungs- und Gerichtsstrukturreform. Für das amerikanische Scheidungsrecht bestimmten transatlantische Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Europa in einem interdisziplinären Kontext ihre Reformbeiträge. Sie kann als Wegbereiterin einer Diversität in der Wissenschaft betrachtet werden. Die wichtigsten Texte werden hier zum Teil auch im Original veröffentlicht.
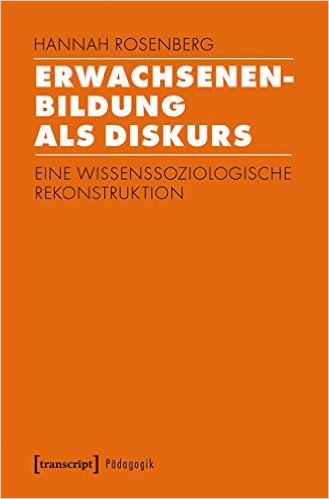
Erwachsenenbildung als Diskurs
Eine wissenssoziologische Rekonstruktion (Pädagogik)
Hannah Rosenberg, transcript Verlag, 2015, S. 226, 34,99€, ISBN 978-3-8376-3254-5
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Wie funktioniert die Disziplin 'Erwachsenenbildung'? Und wie konstituiert sie ihren Gegenstand? Hannah Rosenberg rekonstruiert die Entstehung von 'Erwachsenenbildung' im binnendisziplinären Diskurs über vier Dekaden, indem sie die bislang unabhängig voneinander existierenden Perspektiven der Wissenschafts- und der Diskursforschung systematisch miteinander verschränkt. Sie zeigt, wie durch Leerstellen und Wiederholungen Identitätsprobleme und Blockaden der Disziplin entstehen konnten. Zugleich verweist die Studie auf die Potenziale und damit auf Perspektiven für die weitere Reflexion und Entwicklung der Erwachsenenbildungswissenschaft.
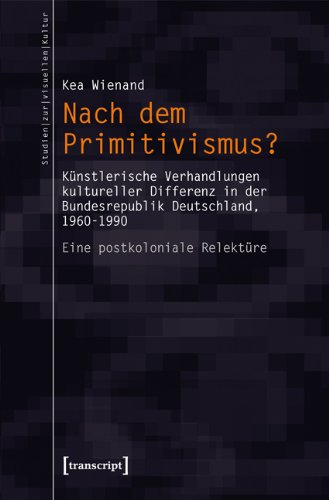
Nach dem Primitivismus?
Künstlerische Verhandlungen kultureller Differenz in der Bundesrepublik Deutschland, 1960-1990. Eine Postkoloniale Relektüre (Studien zur visuellen Kultur)
Kea Wienand, transcript Verlag, 2015, S. 364, 37,99€, ISBN 978-3-8376-2492-2
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die im Nationalsozialismus als »entartet« diffamierte Kunst, die auf vermeintlich »primitive Kulturen« referiert, galt in der Bundesrepublik Deutschland als »antifaschistisch«, ohne dass deren Kolonialrassismen reflektiert wurden. Wie aber wurde kulturelle Differenz in der Kunst der Bundesrepublik von 1960 bis 1990 verhandelt? Kea Wienand diskutiert, inwiefern KünstlerInnen wie Joseph Beuys, Sigmar Polke, Ulrike Rosenbach u.a. nach 1960 einen Primitivismus fortgeführt, verändert oder kritisiert haben. Sie zeigt auf, wie über Bilder von kultureller Differenz Vorstellungen von Künstlerschaft, Sexualität, Geschlecht und Geschichte thematisiert werden.
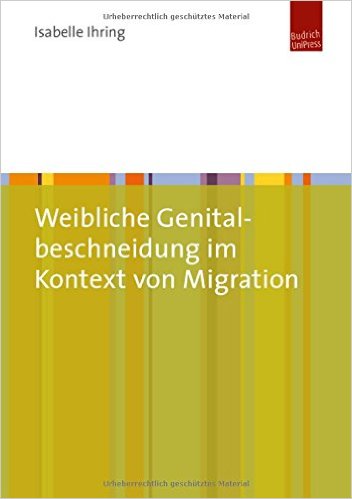
Weibliche Genitalbeschneidung im Kontext von Migration
Isabelle Ihring, Budrich UniPress Ltd. Verlag, 2015, S. 192, 26,90€, ISBN 978-3-86388-707-0
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Weibliche Genitalbeschneidung ist ein Phänomen, das aus verschiedenen Perspektiven betrachtet unterschiedliche Reaktionen hervorruft. Wie erleben betroffene Frauen mit somalischer Herkunft die Praktik im Kontext von Migration? Und welchen Blick haben Fachkräfte der Sozialen Arbeit und migrierte somalische Männer auf weibliche Genitalbeschneidung? Insgesamt wird deutlich, dass die Perspektive betroffener Frauen und Männer in der Sozialen Arbeit in Zukunft deutlich mehr berücksichtigt werden muss.
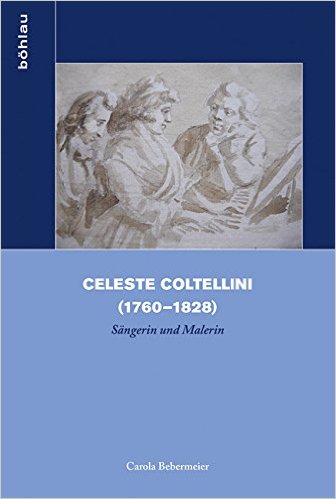
Celeste Coltellini (1760-1828)
Lebensbilder einer Sängerin und Malerin
Carola Bebermeier, Böhlau Köln Verlag, 2015, S. 336, 44,90€, ISBN 978-3-412-22526-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Celeste Coltellini war im späten 18. Jahrhundert eine der gefragtesten und bekanntesten Sängerinnen der Opera buffa in Europa. Selbst aus dem gehobenen bürgerlich-intellektuellen Milieu stammend war sie 13 Jahre als Primadonna an verschiedenen europäischen Theatern engagiert, bevor sie 1792 in die wohlhabende Neapolitanische Familie Meuricoffre einheiratete. Illustre Persönlichkeiten der Zeit standen mit ihr in Kontakt und trafen sich in ihrem Salon. Carola Bebermeier setzt sich theoretisch und praktisch mit den Herausforderungen und Fragestellungen der Frauenbiographik auseinander. Als zentrale Quelle dienen ihr die zehn Skizzenbücher Celeste Coltellinis, die deren gleichwertige zeichnerische Begabung erkennen lassen. Mit einem eigenen biographischen Konzept gelingt es der Autorin, Erkenntnis der neueren Biographikforschung in einer narrativen Form fruchtbar zu machen.
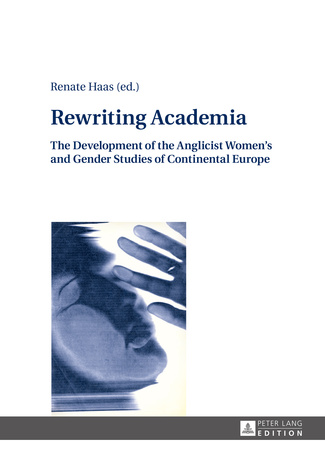
Rewriting Academia
The Development of the Anglicist Women’s and Gender Studies of Continental Europe, Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, 2015. 442 pp. ISBN 978-3-631-66985-3 hb. (Hardcover) SFR 90.00 / €* 79.95 / €** 82.20 / € 74.70 / £ 60.00 / US$ 97.95
From a historical perspective, the full academic establishment of Women’s and Gender Studies is a radical and far-reaching innovation. Decisiveimpulses have come from the United States, the European unification and globalization. European Women’s and Gender Studies are thereforeintimately linked to the English language and Anglophone cultures, as the near untranslatability of «gender» shows. In this volume 25 expertspresent surveys for their countries with a historical and European contextualization and offer fundamental insights not only for English Studiesbut also various other disciplines.
Mehr zum Inhalt Details ausblenden

Frauenkalender der Vernetzungsstelle
Vernetzungsstelle für Gleichberechtigung, Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Hannover, 2015, Aufstellkalender im CD-Format, 2,80€
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Der beliebte Frauenkalender der Vernetzungsstelle liegt für 2015 vor. Es wird die Lebenswelt von zwölf ganz unterschiedlichen Frauen vorgestellt. Interessante Zahlen und Fakten, Link- oder Lesetipps wurden aufgenommen, die neugierig oder nachdenklich machen, die auch in der frauenpolitischen Diskussion hilfreich sein können. Alleinerziehend, bürgerschaftlich engagiert, im Sport, bei uns in einer neuen Heimat, im Internet, in der Politik, in Haft. Das sind einige der Lebenssituationen, die im Kalender zum Thema gemacht werden.
Die Vorderseite des Aufstellkalenders für den Schreibtisch ist mit 12 Frauenportraits oder Fotos zum Thema ansprechend und anspruchsvoll gestaltet. Das Kalendarium enthält neben den gesetzlichen Feiertagen auch frauenpolitisch bedeutsame Tage.
Weitere Informationen und den Bestellbogen finden Siehier.
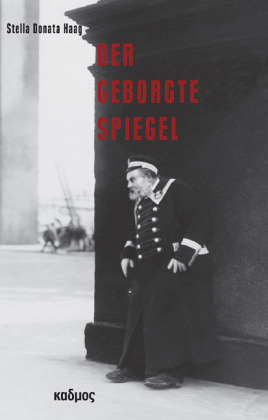
Der geborgte Spiegel
Uniform, Männlichkeit und die photographischen Medien 1870 – 1930
Stella Donata Haag, Kulturverlag Kadmos, 2015, S. 416, 29,80€, ISBN 978-3-8659-9192-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Sie war auch in Deutschland niemals wirklich weg. Sie hatte sich nur verkrochen in eine Nischenexistenz, von der zivilen Mehrheitsgesellschaft ignoriert oder belächelt: die militärische Uniform. Mit ihrer Rückkehr auf die Straßen und Bildschirme ist der Zeitpunkt gekommen, sie als Bildeffekt zu analysieren, als seit 150 Jahren wirksame sartoriale Körpertechnologie und semiotisches Prinzip. In ihrer Gleichzeitigkeit von semantischem Überfluss und subjektiver Verleugnung wird die Uniform zur Bildstörung. Die Prozesse der Zu-, Um und Überschreibung verdichteten sich mit Hochkonjunktur von Militär, medialer Herrschaftsinszenierung und privater Porträtphotographie im Kaiserreich. Doch Verbreitung und Prestige der Uniform im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert markieren zugleich einen kritischen Punkt in der psychohistorischen Entwicklung der westlichen, in besonderer Weise allerdings der deutschen Gesellschaft. Denn die Uniform war in all ihrem Glanze gerade Symptom einer Krise männlicher Subjektivität, eine Textil gewordene Geste kompensatorischer Frustration im Angesicht der Moderne als Zeitalter der Sichtbarkeit, zu dessen Hauptagenten die photographischen Medien zählen und in besonderer Weise das Kino als paradigmatische Kulturtechnik. Der uniformierte Körper antwortet dem Imaginären und wird sich selbst zum Bild: in dem Hochzeitsphoto des unbekannten Infanterie-Vizefeldwebels um 1911, in den Wochenschaubildern der Kaiserparaden oder in der Portiersuniform in F.W. Murnaus ›Der letzte Mann‹ (1925). Das Kino als der wiedergewonnene Spiegel, als das exhibitionistische wie fetischistische Medium ›par excellence‹ (Metz), wiederholt die illusorische Erfüllungsstruktur der Uniform. Bild und Narration dekonstruieren sich dabei oft gegenseitig, so dass mit den Bildern des Triumphes immer wieder die Geschichte der Kastration erzählt wird und sich im Bannkreis der Uniform Erzählungen ablagern, in denen sich die deviante Lust am männlichen Körper manifestiert. Dabei wird eine Linie erkennbar, die vom ›Hauptmann von Köpenick‹ zu Travis Bickle in ›Taxi Driver‹ (1976) führt, von Berlin vor dem Ersten Weltkrieg nach New York post Vietnam – und darüber hinaus auf die Cover der aktuellen Zeitgeistmagazine, in die Bildwelt der Egoshooter und die Bekennervideos auf Al Jazeera.
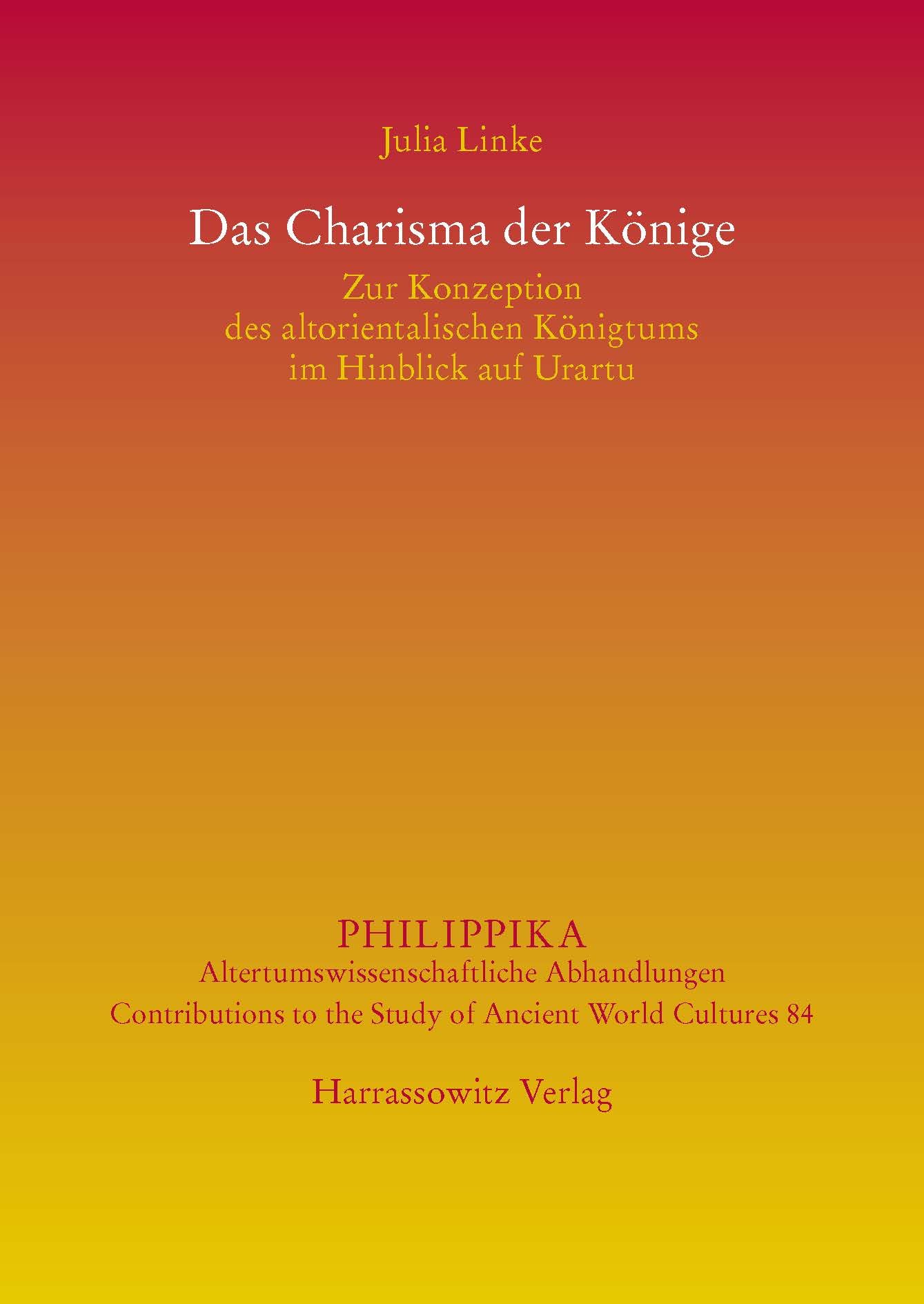
Das Charisma der Könige
Zur Konzeption des altorientalischen Königtums im Hinblick auf Urartu
Julia Linke, Harrassowitz Verlag, 2015, S. 344, 48,00€, ISBN 978-3-4471-0349-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Das altorientalische Reich Urartu mit seinem Zentrum im heutigen Ostanatolien war in seiner Blütezeit (9. bis 7. Jahrhundert v. Chr.) ein ernst zu nehmender Rivale Assyriens. Das Bild, das die zeitgenössischen assyrischen Quellen vom Nachbarn Urartu zeichnen, ist aufgrund der in erster Linie kriegerischen Kontakte zwischen den Reichen zum einen stark tendenziös gefärbt. Zum anderen baut es aber ebenso stark auf dem Selbstbild Assyriens auf und entspricht diesem auch weitgehend – demnach ist Urartu ein zentralisierter Staat, regiert von einem König, aufgeteilt in Provinzen, versehen mit einem differenzierten Beamtenapparat. Die Frage ist, wie weit dieses Bild den tatsächlichen Umständen in Urartu nahekommt und wie in Urartu selbst das Königtum gesehen wird. Schon der Name, den die Urartäer ihrem Land geben, ist ein anderer als der aus Assyrien stammende: Sie nennen es Biainili. Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel, das urartäische Königtum, sein Selbstbild und die Selbstinszenierung seiner Könige so weit wie möglich aus urartäischen Quellen zu erschließen und des Weiteren mögliche Übernahmen aus anderen altorientalischen Kulturen auszumachen. Dabei geht es insgesamt weniger um die Rekonstruktion vorgeblich „historischer Realitäten“ als vielmehr um eine Annäherung an die ideologische Gedankenwelt des urartäischen Königtums. Fokus und roter Faden der Untersuchung ist stets der König als Amtsperson.

Gender in Science and Technology
Interdisciplinary Approaches
Waltraud Ernst, Ilona Horwath (Hrsg.), transcript Verlag, 2014, S. 262, 32,99€, ISBN 978-3-8376-2434-2
Elektronisch in der FWF-E-Book-Library auch frei erhältlich.
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Was ist die Wirkungsweise von Geschlecht in naturwissenschaftlicher Forschung und der Entwicklung neuer Technologien? Das Buch präsentiert methodologische Expertise, Forschungserfahrungen und empirische Ergebnisse im dynamischen Feld der Naturwissenschafts- und Technologieforschung. Themen umfassen die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien, Erkenntnisprozesse in der Biologie und der Chemiegeschichte, Didaktik der Mathematik und Entwicklungen in den Ingenieurberufen.
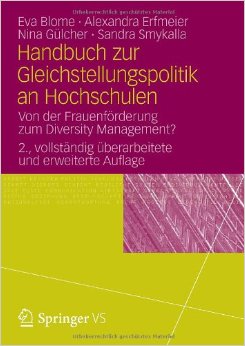
Handbuch zur Gleichstellungspolitik an Hochschulen
Von der Frauenförderung zum Diversity Management?
Nachauflage von Handbuch zur universitären Gleichstellungspolitik: Von der Frauenförderung zum Gendermanagement?
Eva Blome, Alexandra Erfmeier, Nina Gülcher, Sandra Smykalla, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2014, S. 483, 49,99€, ISBN 978-3-5311-7567-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Gleichstellungspolitik an deutschen Hochschulen bewegt sich derzeit im Spannungsverhältnis von aktueller Geschlechterforschung und weitreichenden hochschulpolitischen Transformationen. Das Handbuch reflektiert vor diesem Hintergrund die zunehmende Komplexität gleichstellungspolitischer Arbeit an Hochschulen und trägt zu ihrer Professionalisierung bei. Der erste Teil des Handbuchs vermittelt theoretische Grundlagen. Im zweiten Teil werden gleichstellungspolitische Aufgabenfelder praxisnah vorgestellt und Handlungsmöglichkeiten für verschiedene gleichstellungspolitische Akteurinnen und Akteure - Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte, Hochschul- und Fachbereichsleitungen sowie Mitarbeitende im Hochschul- und Wissenschaftsmanagement - aufgezeigt.
Die Autorinnen sind ehemalige Dezentrale Frauenbeauftragte der Universität Göttingen. Dr. Eva Blome promovierte am Fachbereich Literaturwissenschaft der Universität Konstanz und ist heute Juniorprofessorin für Gender Studies am Institut für Deutsche Philologie der Universität Greifswald. Dr. rer.nat. Alexandra Erfmeier ist Biologin, arbeitet als wissenschaftliche Mitarbeiterin und Privatdozentin am Fachbereich Biologie der Universität Halle-Wittenberg. Nina Gülcher ist Literaturwissenschaftlerin, promoviert am Seminar für Deutsche Philologie der Universität Göttingen und ist Referentin für Gender Mainstreaming im Gleichstellungsbüro der gleichen Universität. Dr. Sandra Smykall ist Pädagogin und Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fachhochschule Kiel im Bereich Hochschuldidaktik aus Gender- und Diversityperspektiven in Zusammenarbeit im dem Team von gleichstellung concret (Weiterbildung und Beratung an Hochschulen).
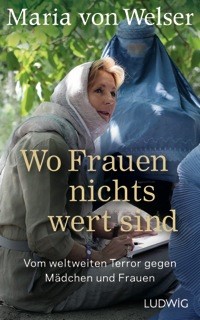
Wo Frauen nichts wert sind
Vom weltweiten Terror gegen Mädchen und Frauen
Maria von Welser, Ludwig Verlag, 2014, S. 320, 19,99€, ISBN 978-3-4532-8060-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Wo Krieg, Armut und Korruption herrschen, sind Frauen die ersten Opfer. Vergewaltigungen an jungen Frauen in Indien machen Schlagzeilen. Wir lesen von massenhaften Abtreibungen weiblicher Föten in Asien. Von Genitalverstümmelung in Afrika. Von öffentlichen Hinrichtungen und Zwangsheiraten. Von Mädchen- und Frauenhandel. Maria von Welser ist in Länder gereist, in denen Frauen nichts wert sind – nach Indien, Afghanistan und in den Kongo –, und hat mit den Frauen und Mädchen gesprochen. Nun erzählt sie ihre Geschichten: Zeugnisse von unendlichem Leid, aber auch des Mutes. Denn: Zunehmend begehren die Frauen auf. Und Maria von Welser gibt ihnen eine Stimme.

Politische Partizipation und Repräsentation von Frauen in Serbien
Stefanie Friedrich, als Band 13 in der Reihe Studien zur Geschichte, Kultur und Gesellschaft Südosteuropas erschienen, LIT Verlag, 2014, S. 392, 49,90€, ISBN 978-3-6431-2365-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Wie gestalteten sich die politischen Partizipationsmöglichkeiten von Frauen in Serbien seit 1945? In welchem Verhältnis steht ihre steigende politische Repräsentation zu den Demokratisierungsprozessen seit dem Jahr 2000? Und wie beeinflussen kulturelle, sozioökonomische, rechtliche und institutionelle Faktoren ihre politische Teilhabe? In dieser Studie wird zunächst aufgezeigt, wie sich die politische Partizipation und Repräsentation von Frauen während des jugoslawischen Sozialismus und während der vom Nationalismus geprägten Zeit der Jugoslawienkriege gestalteten. Im Fokus steht dann die politische Teilhabe von Frauen in Serbien in den ersten zehn Jahren nach dem Sturz Milosevi'cs.
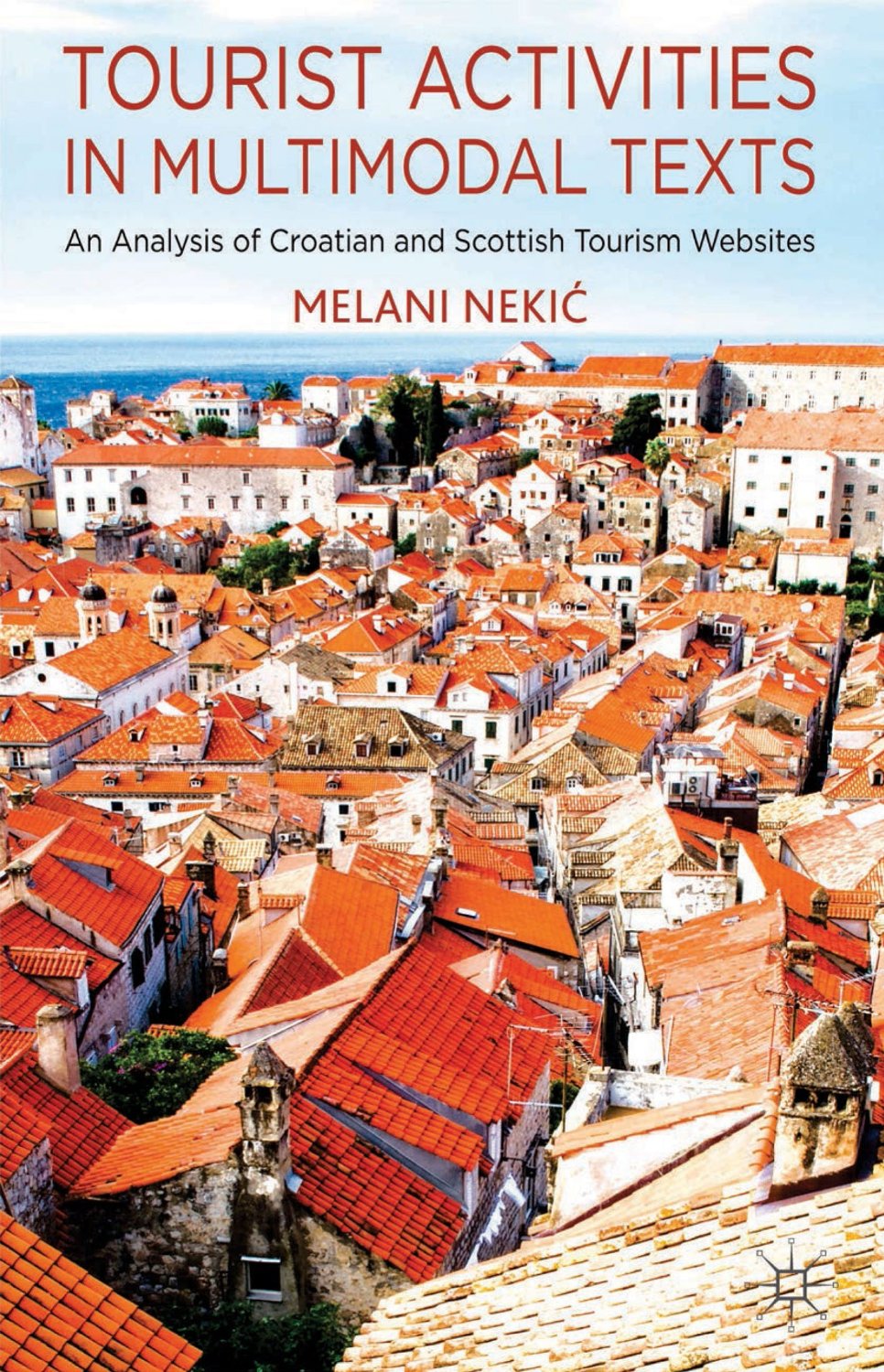
Tourist Activities in Multimodal Texts
An Analysis of Croatian and Scottish Tourism Websites
Melani Nekić, Palgrave Macmillan, 2014, S. 244, 61,14€, ISBN 978-1-1373-9790-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Tourist promotional material is a tool utilised by many people preparing to travel or planning an activity. How do we as readers make sense of the tourist promotional material that is available to us? How do we as users understand tourism websites? Awareness of how tourism websites function may enable business people to master the range of resources used as strategies to design websites in ways which more specifically target types of users. Tourist Activities in Multimodal Texts addresses these questions by analysing Croatian and Scottish tourism web pages to explore the ways in which tourist activities are represented in tourism websites and the ways in which tourism websites construct their recipients as media actors and cultural tourists.
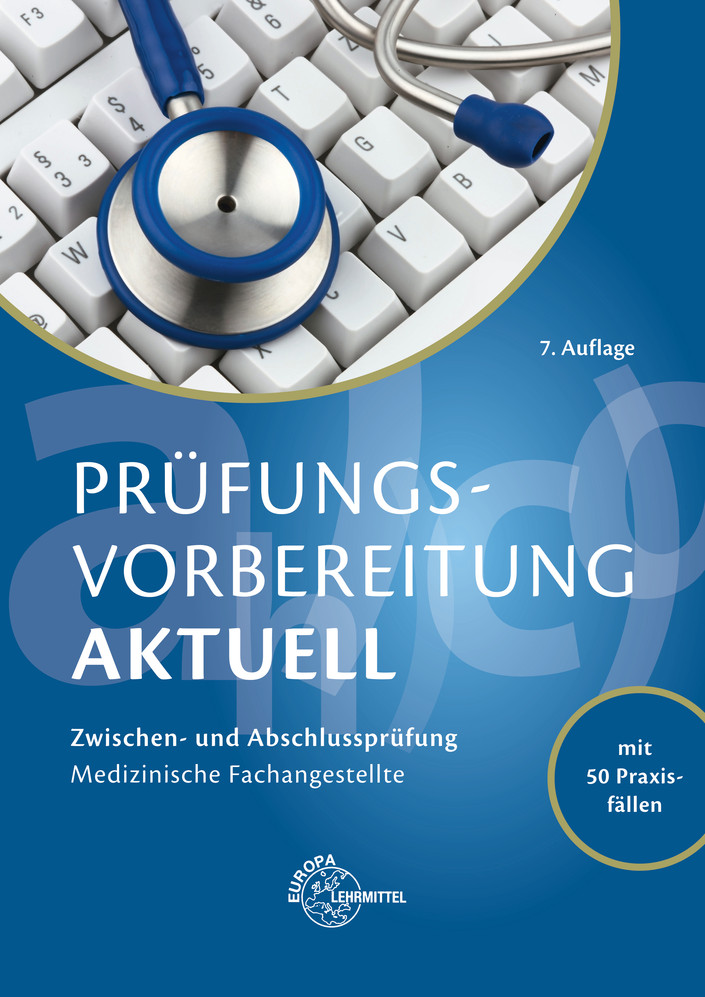
Prüfungsvorbereitung aktuell
Zwischen- und Abschlussprüfung - Medizinische Fachangestellte
Dr. med. Patricia Aden, Dr. Helga Eitzenberger-Wollring, Dr. med. Marie-Theres Eveld, Simone Herz, Uwe Hoffmann, Dr. Susanne Nebel, Dipl.-Hdl. Sabine Padberg, Dr. med. Anneliese Rauhut, Europa Lehrmittel, 2014, S. 640 mit CD, 30,30€, ISBN 978-3-8085-6937-5
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Dieses Buch enthält über 1700 Fragen zur zielgerichteten und systematischen Vorbereitung auf die Zwischen- und Abschlussprüfung. Darüber hinaus kann das Buch zur kontinuierlichen Nachbereitung, zur selbstständigen Überprüfung sowie zur praxisorientierten Anwendung der im Rahmen der Ausbildung erworbenen Kenntnisse genutzt werden. Die Vorbereitung auf die schriftliche Prüfung erfolgt auf der Grundlage zahlreicher programmierter und offener Fragen zu den vier Wissensbereichen Behandlungsassistenz, Betriebsorganisation und -verwaltung, Leistungsabrechnung und Wirtschafts- und Sozialkunde. 50 Praxisfälle ermöglichen ein umfassendes Training der in der praktischen Prüfung geforderten eigenständigen Fallpräsentation. Viele lernfeldübergreifende Einzelfragen und Aufgaben aus allen Wissensbereichen leisten wertvolle Hilfestellungen zur selbstständigen Bearbeitung der Praxissituationen. Aktualisierung und Neubearbeitung in allen Bereichen, insbesondere die Praxisfälle wurden den Prüfungserfahrungen entsprechend neu konzipiert. Modullisten für Behandlungsassistenz und für Verwaltung erleichtern die Übersicht und schaffen zusätzliche Übungsmöglichkeiten.
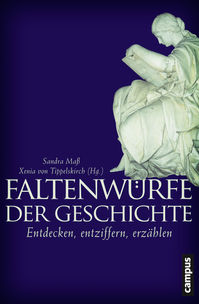
Faltenwürfe der Geschichte
Entdecken, entziffern, erzählen
Sandra Maß, Xenia von Tippelskirch (Hrsg.), Campus Verlag, 2014, S. 518, 56,00€, ISBN 978-3-5935-0167-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Paare, Briefe, Körper, Tanz: Die vielfältigen Beiträge dieses Bands nähern sich mit großem Einfühlungsvermögen der facettenreichen Vergangenheit Europas seit der frühen Neuzeit. Wie durch ein Schlüsselloch geben sie den Blick frei auf ungewöhnliche Alltagsszenen, unerwartete Machtkonstellationen und neu zu deutende Beziehungsgefüge. Die Konzentration auf die Miniatur und das Vergnügen am Erzählen lassen ein vielschichtiges Geschichts- und Menschenbild entstehen – jenseits der einschlägigen Meistererzählungen.
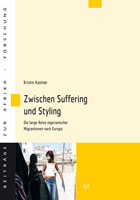
Zwischen Suffering und Styling
Die lange Reise nigerianischer Migrantinnen nach Europa
Kristin Kastner, als Band 53 in der Reihe Beiträge zur Afrikaforschung erschienen, LIT Verlag, 2014, S. 320, 29.90€, ISBN 978-3-6431-1673-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Diese Studie widmet sich den Lebenswelten nigerianischer Migrantinnen im Grenzraum der Meerenge von Gibraltar. Aus einer körperethnologisch orientierten Perspektive nähert sie sich den Grenzerfahrungen der Frauen auf ihrer langen Reise nach Europa. Ihre Körper spielen dies- und jenseits der Meerenge eine zentrale Rolle: Oft Objekt von Leid und Gewalt, ist der Körper in einem flüchtigen Leben unter meist klandestinen Verhältnissen zugleich auch letzte Ressource und entscheidendes Kapital, anhand dessen das Navigieren der Frauen zwischen äußeren Zwängen und individuellem Handlungspotential deutlich wird.
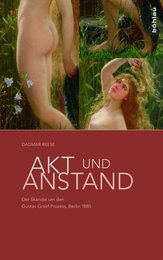
Akt und Anstand
Der Skandal um den Gustav Graef Prozess, Berlin 1885
Dagmar Reese, Böhlau Verlag, 2014, S. 175, 24,90€, ISBN 978-3-4122-2250-5
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Als im März 1885 in Berlin der angesehene Maler und Professor an der Königlich Preußischen Akademie der Künste, Gustav Graef, verhaftet wurde, war dies ein Schock. Man warf ihm vor, mit seinem langjährigen Künstlermodell, Bertha Rother, ein sexuelles Verhältnis unterhalten und darüber vor Gericht gelogen zu haben. Ein halbes Jahr saßen der Künstler, die junge Frau, ihre Schwester und ihre Mutter in Haft, bevor sie Ende September 1885 vor Gericht gestellt und freigesprochen wurden. Der Prozess, von zahlreichen Zeitungen und Zeitschriften beobachtet und kommentiert, wurde zum Skandal weit über Berlin hinaus. Mit einer dichten Beschreibung dieses Falles gibt Dagmar Reese Einblicke in die sich modernisierende Gesellschaft in der deutschen Hauptstadt am Ende des 19. Jahrhunderts.

Warum unsere Studenten so angepasst sind
Christiane Florin, Rowohlt Verlag, 2014, S. 80, 4,99€, ISBN 978-3-4996-1741-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
"Wohl wahr: In jeder Sonntagsrede wird die Bildung zum wichtigsten deutschen Rohstoff erklärt. Aber in den Hörsälen und Seminarräumen sieht die Welt doch ganz anders aus. Die ZEIT-Journalistin Christiane Florin beschreibt hier Debattier-Unlust, Stromlinienförmigkeit, permanenten Performancezwang und den Wunsch der Studenten nach eindeutigen Antworten. Sie entdeckt zwischen Professoren, Dozenten und Studenten eine Art Gleichgewicht des Schreckens: Wenn meine Fehler im Raum bleiben, verlassen auch deine nicht den Saal. Sie wirft mit diesem kleinen Büchlein provokant und mitreißend einen erstaunlichen Blick hinter die Kulissen des Uni-Alltags und beschreibt, was zwischen CreditPoints und PowerPoint-Präsentationen alles im Argen liegt und warum uns allen das nicht egal sein kann.
Ein lesenswerter Diskurs für alle die an Universitäten und Fachhochschulen lehren und lernen."
Maria von Welser
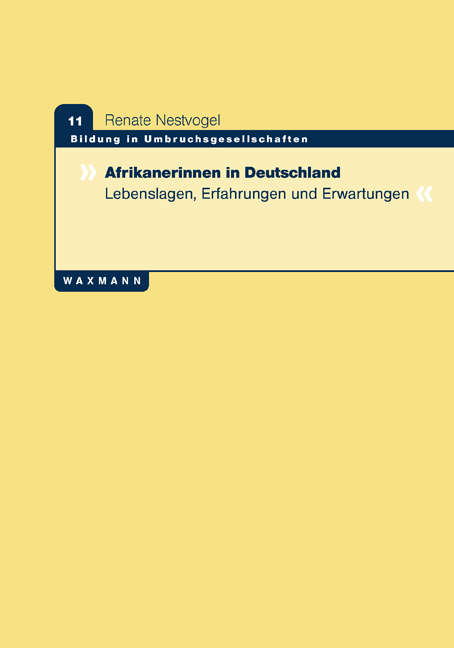
Afrikanerinnen in Deutschland
Lebenslagen, Erfahrungen und Erwartungen
Renate Nestvogel, erschienen in der Reihe Bildung in Umbruchsgesellschaften, Band 11, Waxmann Verlag, 2014, S. 364, 39,90€, ISBN 978-3-8309-3086-0
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In dieser Studie schildern Afrikanerinnen aus Ländern südlich der Sahara ihre Erfahrungen in Deutschland. Die schriftliche Befragung, an der 262 Frauen teilnahmen, umfasste 207 offene und geschlossene Fragen u.a. zu Aspekten wie Sprachkenntnisse, Kindergärten, Schulen, Universitäten, finanzielle Situation, Arbeits- und Wohnungsmarkt, allgemeine Belastungssituationen, Beratungsstellen, Identität, Integrationsvorstellungen, Freizeitgestaltung, Erfahrungen mit Anwälten, Einstellungen zu Prostitution und Gewalterfahrungen. Zusätzlich wurden 43 Afrikanerinnen für eine vertiefte Auseinandersetzung mit den genannten Themen interviewt.
Zwei Drittel berichten von gravierenden Diskriminierungserfahrungen, die ein fragwürdiges Demokratie- und Menschenrechtsverständnis in großen Teilen der deutschen Bevölkerung offenlegen. Diese Befunde stehen in Einklang mit den Ergebnissen zahlreicher sozialwissenschaftlicher Studien, die belegen, dass Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Rassismus in Deutschland weiter verbreitet sind, als allgemein angenommen.
Das Buch richtet sich an Personen, die in Bildungs-, Beratungs- und Betreuungseinrichtungen tätig sind oder in anderen beruflichen Bereichen mit Afrikaner/inne/n zu tun haben, an Migrationsforscher/innen, Politiker/innen und schließlich, im Sinne einer Selbst-Verständigung, an Afrikanerinnen selbst.
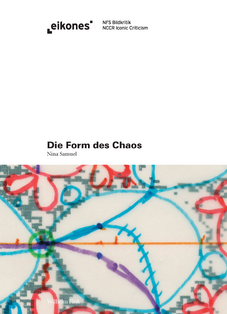
Die Form des Chaos
Bild und Erkenntnis in der komplexen Dynamik und der fraktalen Geometrie
Nina Samuel, mentis Verlag, 2014, S. 551, 78€, ISBN 978-3-7705-5776-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In den letzten Jahrzehnten haben die bildgebenden Möglichkeiten des Computers zum vieldiskutierten »Pictorial Turn« – der Wende zum Bild – in den Naturwissenschaften geführt. Mit dem öffentlichkeitswirksamen Auftritt der Bilder von Chaos und fraktaler Geometrie sowie ihrer breiten Popularisierung ab Mitte der 1980er-Jahre erfasste dieser Trend auch die Mathematik und damit diejenige Disziplin, die als »Reich des reinen Denkens« traditionell für ihre Bilderskepsis bekannt war.Die Bilder dieses Forschungsfelds werden in der vorliegenden Studie zum ersten Mal bildtheoretisch reflektiert und diskutiert. Im Zentrum stehen Arbeitsmaterialien aus privaten Bildarchiven von Mathematikern und Physikern. Eine besondere Rolle spielt dabei die Handzeichnung als Denkform, die auf der Schwelle zum digitalen Medienumbruch eine neue Schwungkraft gewinnt.
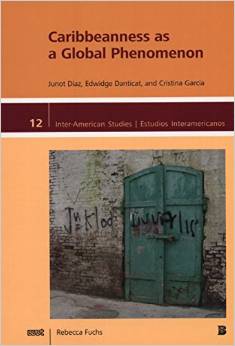
Caribbeanness as a Global Phenomenon
Junot Díaz, Edwidge Danticat, and Cristina Garcia
Rebecca Fuchs, WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 2014, S. 298, 26,50€, ISBN 978-3-8682-1533-5
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Karibik ist räumlich, historisch, kulturell, ethnisch und sprachlich eine ‚Grenzregion‘. Räumlich stellt sie sowohl einen Knotenpunkt zwischen Nord-, Süd- und Mittelamerika dar als auch eine Verbindung zwischen Neuer und Alter Welt, da die Kolonialisierung in der Karibik begann. Historisch trafen im Verlauf der Kolonialisierung zahlreiche Kulturen und Ethnien aufeinander und vermischten sich in Kreolisierungsprozessen. Gemeinsam ist allen karibischen Kulturen die Erfahrung der Kolonialzeit und Sklaverei, die von Gewalt und Ausbeutung geprägt waren. Die Dissertation fußt auf dem Argument, dass aus dieser Geschichte eine kollektive karibische Identität hervorging, die sogenannte ‚Caribbeanness‘. Diese äußert sich vor allem darin, dass die Menschen gelernt haben, mit gewaltsamen Erfahrungen umzugehen und zu überleben, was sich bis heute in kreativen Werken in Kunst, Literatur und Musik niederschlägt. Diese kreativen Strategien werden in der Studie herausgearbeitet, denn sie sind über den karibischen Kontext hinaus wertvoll. Die Karibik produziert Wissen und Lösungsstrategien für komplexe Probleme wie Gewaltherrschaft, Unterdrückung und Traumatisierung, die auch in anderen kulturellen Kontexten angewendet werden können und von dem das westliche Wissenssystem profitieren kann. Dadurch wird gezeigt, dass die Karibik nicht nur von globalen Einflüssen geprägt ist, sondern dass karibisches Denken und Wissen global relevant sind, wodurch eine Wechselbeziehung zwischen der Karibik und den ehemaligen (Neo-)Kolonialmächten betont wird.
Untersucht werden zwei Romane und ein Kurzgeschichtenzyklus von zwei karibischen Diasporaautorinnen und einem Diasporaautor, die in den U.S.A. leben. Sie sind Grenzgänger zwischen den Kulturen und kennen die Karibik ‚von Innen‘, aber nehmen auch eine distanziertere Außenperspektive ein. Ihre literarischen Werke werden in Dialog mit karibischer Theorie gelesen, die in der westlichen Forschung bislang nicht als gleichwertig in Bezug auf westliche Theorie akzeptiert wird. Dadurch werden auch die Grenzen zwischen Literatur und Theorie überschritten, denn die karibischen Texte erzählen Geschichten und theoretisieren gleichzeitig. Ein Beispiel ist die Verwendung von verschiedenen Erzählsituationen in den Texten. Der zentrale Ich-Erzähler in Díaz‘ Roman The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, der keine anderen Figuren zu Wort kommen lässt, kann noch so vehement gegen den Diktator anschreiben; er bleibt bis zu einem gewissen Punkt selbst autoritär. Dadurch werden Strategien notwendig, die die Machtposition des Erzählers schwächen, zum Beispiel andere Versionen einer Geschichte, die der Erzähler selbst in Form von Intertexten (Anspielungen auf andere literarische Werke) einfügt.
In karibischer Diasporaliteratur spielt das Thema Gender in Bezug auf Grenzüberschreitungen eine zentrale Rolle. Der Protagonist Oscar in Junot Díaz‘ Roman kämpft beispielsweise mit seiner Rolle als dominikanischer Mann, von dem Machogehabe, Stärke und mitunter sogar Gewaltbereitschaft erwartet wird. Opfer dieser Rollenverteilung sind die Frauen im Roman, Oscars Mutter Beli, seine Schwester Lola und seine Geliebte Ybón, die verprügelt, vergewaltigt, gedemütigt und vertrieben werden, sobald sie sich nicht rollenkonform verhalten. Dennoch überschreiten alle Figuren im Roman die ihnen auferlegte Grenze zwischen den Geschlechtern und rebellieren gegen die Machtstrukturen der diktatorischen und vormals kolonialen Kontrollinstanzen. Anstatt ein Macho zu werden, bevorzugt Oscar science fiction und wird Schriftsteller. Als er sich in die Prostituierte Ybón verliebt, setzt er sein Leben aufs Spiel, um sie der Kontrolle eines typischen Machos zu entreißen. Auch wenn er dabei am Ende sein Leben verliert, erzählt sein Freund Yunior seine Geschichte und schreibt sie fort, indem er selbst gegen diktatorische Machtstrukturen anzuschreiben, die er auch in sich selbst vorfindet. Dieser Akt der Sichtbarmachung und die Entwicklung von Gegenmaßnahmen werden als dekoloniale Befreiungsstrategien gelesen, die die noch anhaltende Macht des Diktators aufbrechen.
Das Denken und Wissen ‚subalterner‘, marginalisierter Kulturen oder ethnischer Gruppen bietet eine neue, erweiternde Perspektive, die die Stellung des westlichen Wissens als zentrales, universelles System, das eng mit politischer und wirtschaftlicher Macht gekoppelt ist, herausfordert. Dadurch wird bewusst gemacht, dass westliches Wissen nur eine lokale Wissensform unter vielen ist, die nicht global für alle Kulturen angewendet werden kann. Damit einher gehen sozialer und politischer Wandel, denn bisher marginalisierte Kulturen werden nicht mehr nur als ‚Untersuchungsobjekte‘ angesehen, sondern als Subjekte, die selbst Wissen produzieren. Diese ‚Dekolonialisierung‘ des Wissens und Denkens ist essentiell, um noch immer auf Kolonialität basierende Machtstrukturen aufzubrechen und die Unabhängigkeit der ehemals Kolonisierten von politischer zu epistemischer Freiheit auszuweiten. Darüber hinaus ist das Ziel die Kreolisierung des Wissens, ein Dialog auf Augenhöhe zwischen in diesem Fall U.S.-amerikanischem/europäischem und karibischem Wissen. Karibische Diasporaliteratur und Theorie als Orte der Wissensproduktion bieten auch für andere kulturelle Kontexte Lösungsansätze, die nicht ungenutzt bleiben sollten. Vom Dialog zwischen verschiedenen kulturellen Wissenssystemen auf Augenhöhe profitieren alle, denn er bietet Strategien, die auf komplexe Problemfelder in unterschiedlichen globalen Kontexten angewendet werden können.
Im Konsens 3/2015 erschienen
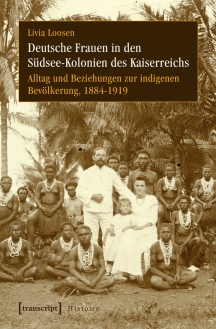
Deutsche Frauen in den Südsee-Kolonien des Kaiserreichs
Alltag und Beziehungen zur indigenen Bevölkerung, 1884 – 1919
Livia Loosen, transcript Verlag, 2014, S. 675, 49,99€, ISBN 978-3-8376-2836-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Kolonialgeschichte des Deutschen Kaiserreichs ist kurz und endete mit dem 1. Weltkrieg. Seine Kolonien befanden sich vor allem in Afrika. Wenn wir an deutsche Kolonien denken, steht Südwestafrika, das heutige Namibia, ganz oben in unserer Erinnerung. Aber auch in der Südsee gab es einige Inseln, die deutsche Kolonien waren.
Auch in der deutschen wissenschaftlichen Literatur spielt vor allem die Beschäftigung mit den afrikanischen Kolonien eine Rolle. Die Südsee-Kolonien waren eine Nebensache. Livia Loosen hat mit ihrer Doktorarbeit besonders in Bezug auf die Rolle der deutschen Frauen in den deutschen Kolonien der Südsee einen bedeutenden Beitrag zur Kolonialgeschichte erstellt.
Durch ihre umfangreichen Recherchen stand ihr unter anderem bisher unbekanntes, nicht veröffentlichtes Primärmaterial aus Privatbesitz zur Verfügung. Die Informationen aus den vielen Briefen und Berichten der deutschen Frauen in den Südsee-Kolonien, sei es an die Verwandtschaft oder auch an die sie entsendenden kirchlichen Missionen oder weltlichen Hilfsorganisationen wurden in dieser Arbeit hervorragend aufgeschlüsselt, wobei allerdings Wiederholungen nicht ausbleiben konnten. Bestimmte Aussagen und Beschreibungen können eben verschiedenen Analysekategorien zugeordnet werden.
Aber durch die vielen, verschiedenen Analyseaspekte wird der Alltag der Frauen in der Südsee sehr transparent.Beim Lesen dieser über 600 Seiten starken Dissertation darf man nicht vergessen, dass es eine historische Arbeit ist, keine sozialwissenschaftliche. Es geht nicht um Frauenrechte , nicht um Emanzipation, sondern um die Darstellung weiblicher Lebenswelten in ausgesprochen dienender Funktion, die von den Frauen selbst gewählt wurde und völlig dem Zeitgeist entsprach. Dabei thematisiert die Verfasserin diese Grundeinstellung der Frauen immer wieder und weist auf das weitgehende Fehlen von emanzipatorischen Gedanken bei den Frauen hin. Das Rollenverständnis aller deutschen Frauen in den Südsee-Kolonien war dem traditionellen europäischen Frauenbild des Bürgertums verhaftet: Die Frau als Dienerin des Mannes und als seine Gefährtin.
Alle die Frauen, die Schriftliches hinterlassen haben, waren offensichtlich noch nicht mit den Gedanken der deutschen Frauenbewegung, wie sie sich in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelten, in Berührung gekommen. Diese Gedankenwelt war ihnen offensichtlich fremd. Sie wird von keiner Frau thematisiert.
Insofern bietet das Buch von Livia Loosen einen guten Einblick in die Denk- und Verhaltensweisen der meist bürgerlichen Frauen aus dem deutschen Mittelstand, die in die Südsee als Ehefrauen, Missionsangehörige, Krankenschwestern oder Lehrerinnen reisten. Es ist darüber hinaus auch ein guter Beitrag zu Denk- und Verhaltensweisen von deutschen Frauen des Mittelstandes überhaupt. Es ist aber kein Beitrag zum Aufbruch der Frauen in die Gleichberechtigung. Diesen Anspruch stellt die Autorin auch nicht. Sie will eine historische Wissenslücke schließen und das ist ihr sehr gut gelungen.
Dr. Vera Gemmecke-Kaltefleiter
Gruppe Kiel
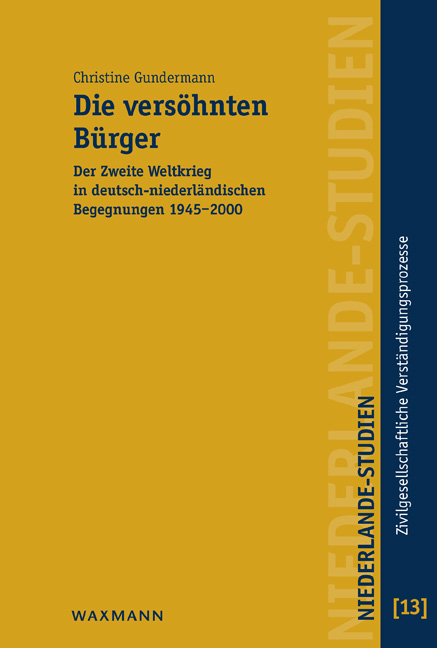
Die versöhnten Bürger
Der Zweite Weltkrieg in deutsch-niederländischen Begegnungen 1945–2000
Christine Gundermann, als Band 13 in der Reihe Zivilgesellschaftliche Verständigungsprozesse vom 19. Jahrhundert bis zur Gegenwart erschienen, Waxmann Verlag, 2014, S. 470, 49,90€, ISBN 978-3-8309-3129-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Der Zweite Weltkrieg ist bis heute ein historisches Bezugsereignis für die Niederlande und die Bundesrepublik Deutschland und hat über Jahrzehnte hinweg die Beziehungen beider Staaten zueinander bestimmt. Welche Rolle spielte der Krieg aber jenseits der Außenpolitik und medialer Zuschreibungen in konkreten Begegnungen von Bürgerinnen und Bürgern beider Staaten nach 1945? In der vorliegenden Studie werden zivilgesellschaftliche Kontakte anhand von acht Mikrostudien in unterschiedlichsten Feldern untersucht. Die Autorin zeigt auf diese Weise ein neues Feld grenzüberschreitender bürgerlicher Erinnerungskulturen jenseits nationaler Geschichtspolitik auf, in dem auf vielfältige Weise Formen der Versöhnung verhandelt wurden. Solche Begegnungserinnerungen hatten jedoch nicht zwangsläufig eine Aufarbeitung der schmerzhaften Vergangenheit zur Folge. Die hier vorgestellten transnationalen zivilgesellschaftlichen Versöhnungsbemühungen eröffnen damit neue Einsichten in die deutsch-niederländischen Nachkriegsbeziehungen.
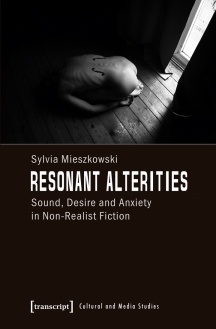
Resonant Alterities
Sound, Desire and Anxiety in Non-Realist Fiction
Sylvia Mieszkowski, transcript Verlag, 2014, S. 402, 36,99€, ISBN 978-3-8376-2202-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
»Resonant Alterities« bridges the gap between sound studies and literary criticism. A queer ghost story by Vernon Lee, an occultist novel of psychic adventure by Algernon Blackwood, a dystopian science fiction tale by J.G. Ballard and a post-traumatic short novel by Don DeLillo are its primary objects of analysis. Each is explored within the context of its contemporary cultural debates on sound. Meanwhile, all four theory-enriched readings focus on intersecting and desire-laden processes of meaning making, knowledge production and subject formation. Focal points are aurally/audio-visually structured phenomena expressive of both collective and individual anxieties.
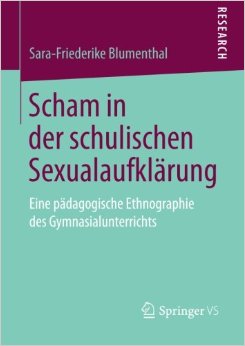
Scham in der schulischen Sexualaufklärung
Eine pädagogische Ethnographie des Gymnasialunterrichts
Sara-Friederike Blumenthal, Springer Verlag, 2014, S. 172, 34,99€, ISBN 978-3-6580-6879-0
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Im Kontext von unterschiedlichen psychologischen Konzepten erläutert die Verfasserin den Begriff Scham und grenzt ihn von Schuld, Peinlichkeit und Verlegenheit ab. In der Einleitung heißt es dazu: „Die Dateninterpretation zeigt fallübergreifend, dass Lehrende die Praxis der Beschämung in der Sexualaufklärung als Erziehungsmittel nutzen. Sie zeigt aber auch, dass SchülerInnen Lehrenden gegenüber Beschämung ausüben. Es wird deutlich gemacht werden, dass Beschämung nicht nur durch Erniedrigung oder Ausgrenzung einzelner Personen oder Personengruppen ausgeübt werden kann. Auch schulische Arrangements, wie etwa die thematischen Gliederung der Unterrichtsinhalte oder die Darstellung von Körpern in der Sexualaufklärung transportieren Aussagen über soziale Ordnungen.“Gegenstand der Forschung waren Kommunikationsprozesse in der schulischen Sexualaufklärung. Die Verfasserin hat dazu vier Gymnasialklassen in Berlin beim Sexualkundeunterricht begleitet Aus den Unterrichtsnotizen, den Video- und Tonaufzeichnungen, sowie den Interviews fließen viele Originalzitate in den Text ein.Aus der Interpretation der Ergebnisse zieht die Autorin praxisrelevante Folgerungen, die für eine große Zielgruppe bedeutsam sind.
(Dr. med. Patricia Aden)
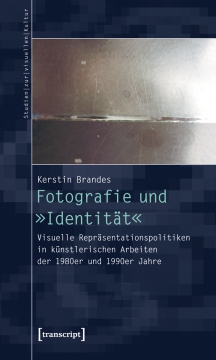
Fotografie und „Identität“
Visuelle Repräsentationspolitiken in künstlerischen Arbeiten der 1980er und 1990er Jahre
Kerstin Brandes, transcript Verlag, 2014, S. 288, 34,80€, ISBN 978-3-8394-1586-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Als ein zentrales Medium der visuellen Repräsentation von »Identität« hat die Fotografie in den letzten drei Jahrzehnten einen zunehmend wichtigen Platz auch in künstlerischen Projekten erhalten. Kerstin Brandes fragt nach Möglichkeiten einer emanzipatorischen visuellen Politik und zeigt, wie die Verknüpfung postkolonialer und feministischer Theorien mit Theorien der Fotografie neue Blickweisen auf die Bilder eröffnet.
Künstlerische Arbeiten von Barbara Kruger, Carrie Mae Weems, Lorna Simpson u.a. werden dabei nicht als zu analysierende Objekte, sondern als Herausforderung für ebendiese Theorien diskutiert. Der Band bietet zudem eine kritische Revision des gegenwärtigen fotografischen Diskurses.
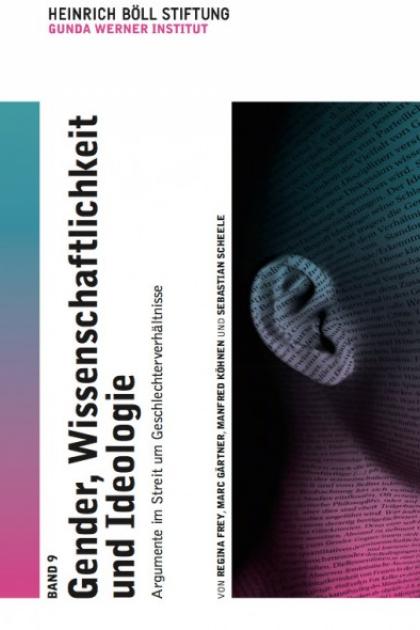
Gender, Wissenschaftlichkeit und Ideologie
Argumente im Streit um Geschlechterverhältnisse
Regina Frey, Marc Gärtner, Manfred Köhnen, Sebastian Scheele, Erschienen in der Schriftenreihe des Gunda-Werner-Instituts, Band 9, Heinrich-Böll-Stiftung, 2014, S. 84, kostenlos, ISBN 978-3-8692-8113-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Geschlechterthemen haben Konjunktur. Die neue Sexismus-Debatte, Quotenregelungen für Aufsichtsräte, die rechtliche Gleichbehandlung eingetragener Lebenspartnerschaften: Gesellschaftliche Geschlechterverhältnisse werden intensiv und kontrovers diskutiert. Zugleich ist ein deutlicher Gegenwind zu spüren, wenn es um Geschlechterforschung geht. Wer mit dem Begriff „Gender“ arbeitet, wird nicht selten mit dem Vorwurf einer prinzipiellen Unwissenschaftlichkeit konfrontiert. Den Gender Studies wird der Status einer Wissenschaft abgesprochen, Gender sei per se kein wissenschaftliches Konzept, sondern eine Ideologie. Der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit ist nicht neu. In Mainstream-Medien wie F.A.Z., Der Spiegel oder Focus wird Personen Raum gegeben, die diesen Generalverdacht verbreiten. Zuletzt entfachte Harald Martenstein im ZEIT-Magazin Anfang Juni mit "Schlecht – schlechter - Geschlecht" eine solche Debatte.
Die Publikation geht dem Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit nach und gibt Argumente für eine Auseinandersetzungen an die Hand. Im Schlagwort „Genderismus“ zum Beispiel werden unterschiedlichste Sachverhalte aus Geschlechterforschung und Gleichstellungspolitik vermischt. Es werden mediale Entstehungsmythen des Begriffs Gender nachgezeichnet und Verzerrungen in der Darstellung des Genderdiskurses beleuchtet. Der Begriff „Gender-Ideologie“ wird unter die Lupe genommen: Er soll delegitimieren, wirft dabei aber Fragen auf, zu deren Beantwortung gerade die Gender Studies viel beitragen können. Es wird erläutert, welchem Wissenschaftsverständnis der Vorwurf der Unwissen-schaftlichkeit entspringt. Beispiele zeigen, wie sehr der Vorwurf der Unwissenschaftlichkeit auf einem Doppelstandard basiert und sich – ganz entgegen dem eigenen Anspruch auf Neutralität und Objektivität – als politisch motiviert erweist.
Die Broschüre kann kostenlos hier heruntergeladen werden.
Effects of multiple abiotic stressors on the species and genetic biodiversity of littoral Cladocera in two types of acidic habitats in Germany: hard-water mining lakes and soft-water bog lakes
Maria Belyaeva, Shaker Verlag, 2013, S. 172, 48,80 € , ISBN 978-3-8440-2391-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In der Vergangenheit konzentrierte sich die ökologische Forschung über saure Seen auf Weichwasserseen, während Lebensgemeinschaften in natürlichen oder künstlichen sauren Hartwasserseen kaum untersucht wurden. Die Dissertation behandelt die Effekte multipler abiotischer Stressoren auf die Arten- und genetische Diversität litoraler Cladoceren in zwei unterschiedlichen Typen saurer Gewässer: Hartwasser-Tagebauseen und Weichwasser-Moorseen.
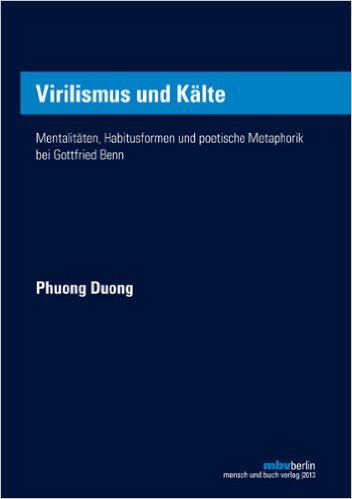
Virilismus und Kälte
Mentalitäten, Habitusformen und poetische Metaphorik bei Gottfried Benn
Phuong Duong, Mensch und Buch Verlag, 2013, S. 278, 39,90€, ISBN 978-3-8638-7343-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
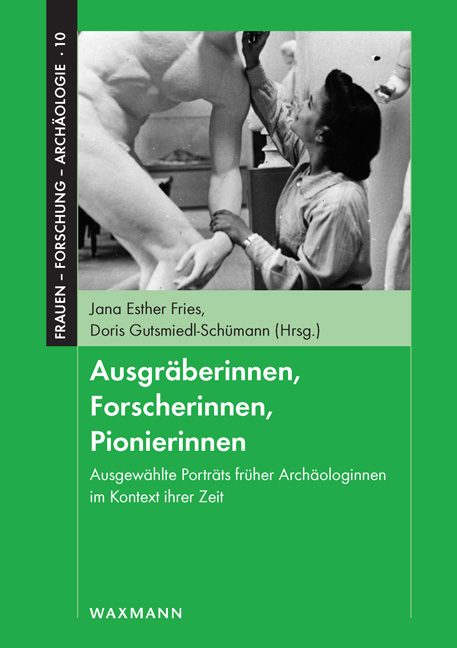
Ausgräberinnen, Forscherinnen, Pionierinnen
Ausgewählte Porträts früher Archäologinnen im Kontext ihrer Zeit
Jana Esther Fries, Doris Gutsmiedl-Schümann (Hrsg.), als Band 10 in der Reihe Frauen – Forschung – Archäologie erschienen, Waxmann Verlag, 2013, S. 288, 24,90€, ISBN 978-3-8309-2872-0
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die ersten Archäologinnen waren im doppelten Sinne Pionierinnen. Sie leisteten wichtige Anteile an der Entwicklung ihrer akademischen Fächer und übernahmen zudem auf Ausgrabungen, in Museen und Universitäten für Frauen in der damaligen Zeit ganz ungewöhnliche Aufgaben. Im zehnten Band der Reihe Frauen – Forschung – Archäologie wird plastisch dargestellt, was es für Frauen ab Mitte des 19. Jahrhunderts hieß, Archäologin zu sein. Die Haltungen von Familien und sozialem Umfeld zu den grabenden und forschenden Frauen werden ebenso geschildert wie Förderung und Behinderung durch eine männlich geprägte Fachwelt, die Schwierigkeiten, die es den Frauen bereitete, Archäologie und Familie unter einen Hut zu bringen und die dauerhafte Würdigung in der Fachgeschichte.Von der frühesten sächsischen Archäologin über Pionierinnen der Klassischen Archäologie in den USA und Großbritannien bis zur ersten Professorin in der Türkei werden Porträts von 19 Frauen gezeichnet, von denen jede auf ihre Weise archäologisches Neuland erschloss.
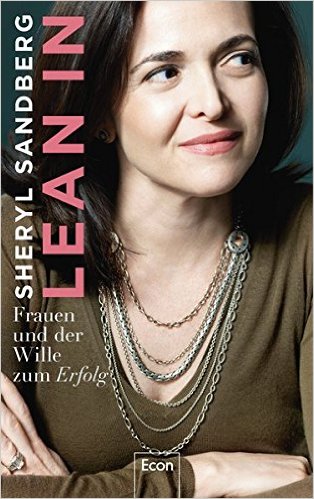
Lean In
Frauen und der Wille zum Erfolg
Sheryl Sandberg, Ullstein eBooks 2013, S. 312, 19,99€, ISBN 384370578X, 9783843705783,
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In Deutschland sitzen in den Vorständen der 100 umsatzstärksten Firmen gerade einmal 3 Prozent Frauen. International sieht es nicht viel besser aus. Sheryl Sandberg aber ist ganz oben angekommen. Sie ist Geschäftsführerin von Facebook und gehörte davor zur Führungsmannschaft bei Google. Außerdem erzieht sie zusammen mit ihrem Mann Dave zwei Kleinkinder. Sheryl Sandberg ist eine der wenigen sichtbaren Top-Managerinnen weltweit und ein Vorbild für Generationen von Frauen. In ihrem Buch widmet sie sich ihrem Herzensthema: Wie können mehr Frauen in anspruchsvollen Jobs an die Spitze gelangen? Sie beschreibt äußere und innere Barrieren, die Frauen den Aufstieg verwehren. Anhand von unzähligen Beispielen und Studien zeigt Sandberg, wie jede Frau ihre Ziele erreichen kann und welche Kleinigkeiten dem Erfolg manchmal im Wege stehen.
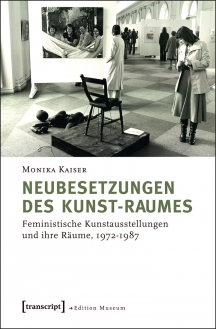
Neubesetzungen des Kunst-Raumes
Feministische Kunstausstellungen und ihre Räume, 1972-1987
Monika Kaiser, transcript Verlag, 2013, S. 298, 35,80€, ISBN 978-3-8376-2408-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Wie stehen Kunst und weibliche Emanzipation in Zusammenhang? Mit einem Spannungsbogen von den hochpolitischen Anfängen feministischer Künstlerinnenausstellungen am Anfang der 1970er Jahre bis zu deren subversiven Ausläufern Mitte der 1980er Jahre stellt Monika Kaiser internationale Projekte wie Womanhouse (Judy Chicago), Magna Feminismus und Kunst mit Eigen-Sinn (Valie Export) sowie sechs weitere exemplarische Ausstellungen in einen neuen, am Raum orientierten Bedeutungszusammenhang.Unveröffentlichtes Quellenmaterial ermöglicht die Rekonstruktion konkreter Ausstellungsräume und gibt Einblick in einen bislang unterschätzten Teil emanzipatorischer Ausstellungskultur.
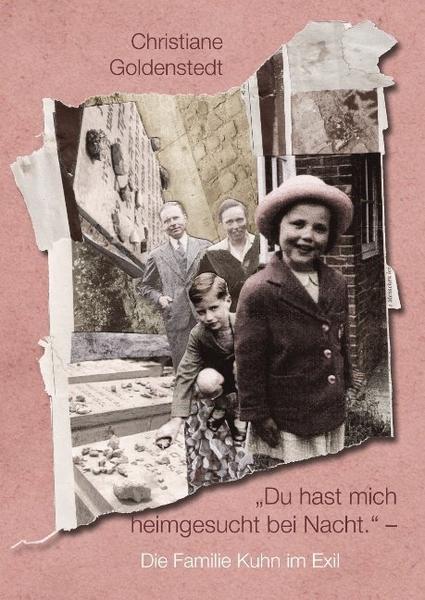
"Du hast mich heimgesucht bei Nacht"
Die Familie Kuhn im Exil
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Emigranten seien „Vertriebene", „Verbannte" gewesen, so Bertolt Brecht in seinem Gedicht, trifft für die Familie Kuhn sicherlich zu. Im englischen Exil drohte Käthe Kuhn – trotz der unermüdlichen Unterstützung von Gertrud Bing vom Warburg-Institut –, fast zu zerbrechen. Die Sehnsucht nach der Heimat war in den Jahren des Exils immer spürbar. So betonte auch Annette Kuhn, dass das Wort "Heimat" in den USA für sie eine magische Kraft besessen habe: "the treasured word". Der Erwerb der amerikanischen Staatsbürgerschaft konnte das Gefühl der Fremdheit nicht überdecken. Die Kuhns bauten viele Brücken mit dem Nachkriegsdeutschland. Dazu gehörte der Kontakt mit deutschen Kriegsgefangenen in den USA und mit ehemaligen Widerstandsfamilien des 20. Juli 1944. Hier ist im Besonderen der unermüdliche Einsatz von Käthe Kuhn, das Leben der Hinterbliebenen des deutschen Widerstands zu erleichtern. Käthe Kuhns Aufopferung erinnert an das Wirken von Gertrud Bing im Warburg Institut. Auch Käthe Kuhn hatte die Hoffnung von einem besseren Deutschland. Mit der Herausgabe der Abschiedsbriefe und Aufzeichnungen des Widerstandes waren Käthe Kuhn, Helmut Gollwitzer und Reinhold Schneider in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und des Widerstandes ihrer Zeit weit voraus.
Aus Thalia.de, https://tinyurl.com/5n72vhmh
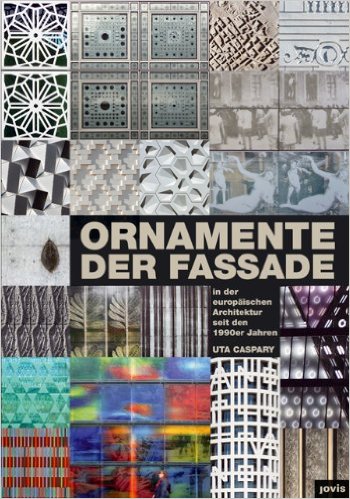
Ornamente der Fassade in der europäischen Architektur seit den 1990er Jahren
Uta Caspary, Jovis Verlag, 2013, S. 336, 35€, ISBN 978-3-8685-9233-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Abwechselnd gefeiert und verurteilt, zugleich historisch rückgebunden wie zukunftsweisend, ist das Ornament eine wesentliche, nicht selten unterschätzte Vokabel der Architektursprache. Dieses Buch fächert den Ornamentdiskurs seit dem 19. Jahrhundert aus kulturhistorischer Sicht auf und nutzt ihn als Hintergrund für eine umfassende Darstellung und Analyse der gegenwärtigen Ornamenttheorie und -praxis. Dabei stehen die kommunikative Qualität und die ästhetische Faszination von aktuellen Fassaden-Ornamenten im Mittelpunkt. Zahlreiche Beispiele veranschaulichen ein großes Spektrum ornamentaler Erscheinungsformen, das von regionalen Traditionen und Vorlagen der bildenden Kunst über den Formenschatz der Natur bis hin zu den bewegten Licht-Ornamenten der Digitalfassaden reicht. In seiner Verbindung von Architektur-, Kunst- und Kulturgeschichte ist dieser Beitrag zur Ornamentdebatte im 21. Jahrhundert wegweisend.
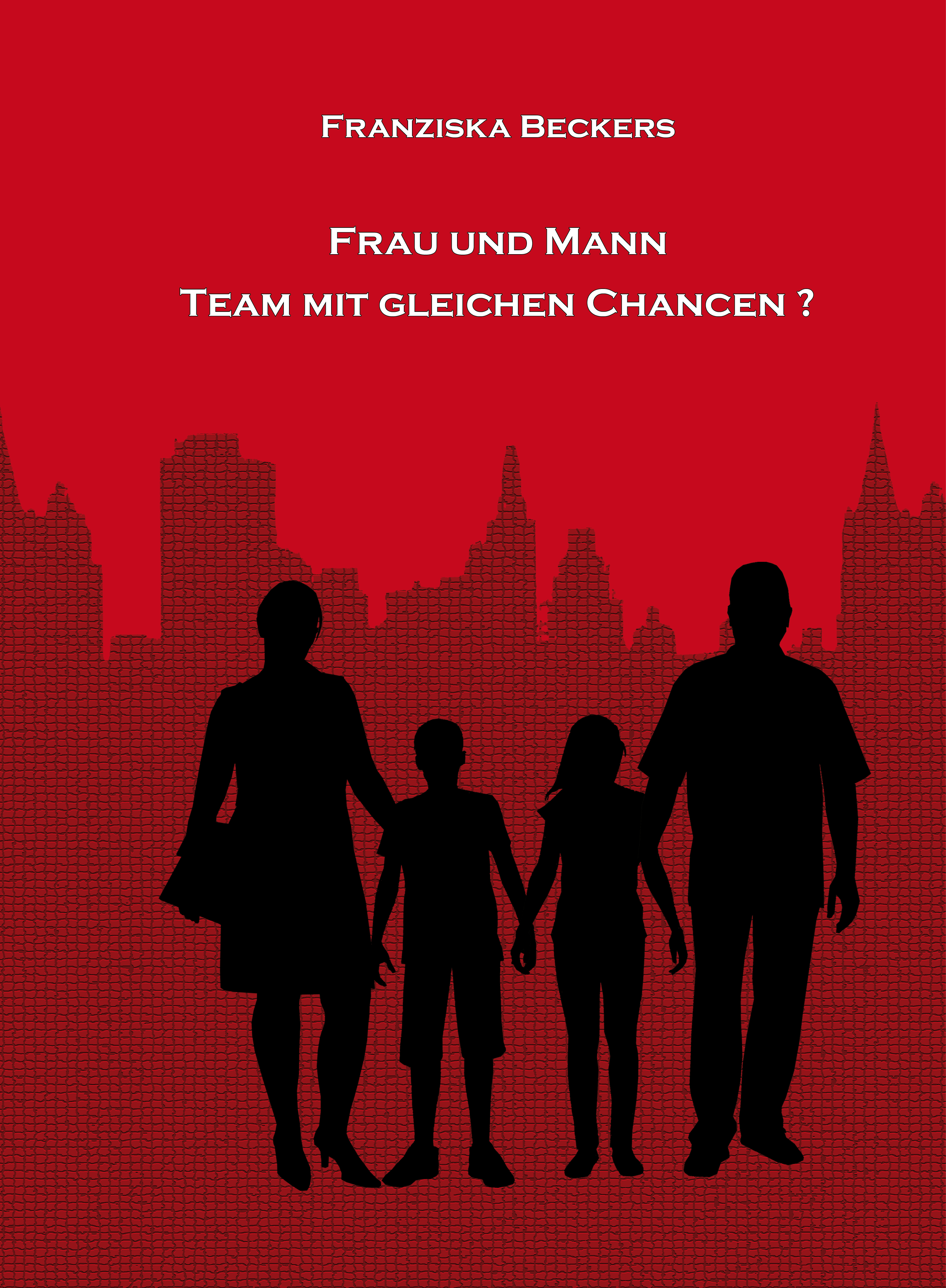
Frau und Mann - Team mit gleichen Chancen?
Franziska Beckers, LITTERA-Verlag, 2013, 224 Seiten, 17,90, ISBN 978-3981586732
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Das Buch bietet einen historischen und aktuellen Überblick zu den Themen „Frauenförderung“ und „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“. Die Autorin schildert dazu ihre eigenen Erfahrungen und führt Interviews mit Personen aus den Bereichen Erziehung, Wirtschaft und Politik durch. Es ist ein Plädoyer für die Familie und für das erfolgreiche Team „Frau und Mann“! Es soll jungen Menschen Mut machen auf dem Weg in eine erfolgreiche familiäre und berufliche Zukunft.
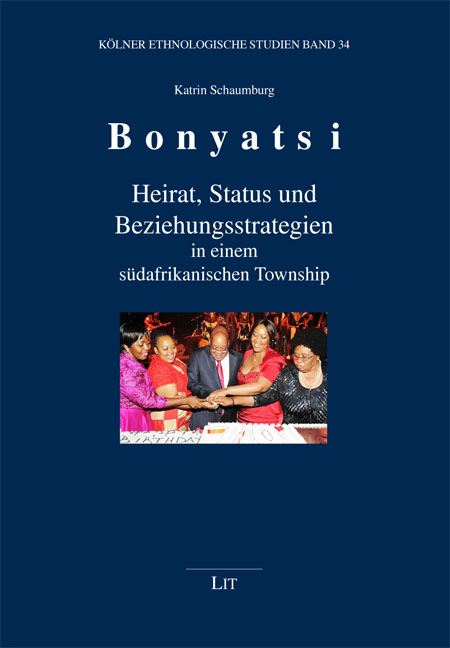
Bonyatsi
Heirat, Status und Beziehungsstrategien in einem südafrikanischen Township
Katrin Schaumburg, als Band 34 in der Reihe Kölner ethnologische Studien erschienen, LIT Verlag, 2013, S. 296, 29,90€, ISBN 978-3-6431-2205-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Mit dem vorliegenden Buch stellt die Autorin die bevorzugte Beziehungsstrategie einer bestimmten Gruppe von Frauen im Township Mamelodi vor: Bonyatsi. Obwohl Eheschließungen einen hohen sozialen Status versprechen, entschließen sich diese Frauen dazu, eine Beziehung mit einem gut situierten, aber bereits verheirateten Mann einzugehen. Die Autorin zeigt mittels zahlreicher Lebensgeschichten und qualitativer Interviews, wie bonyatsi den Frauen ermöglicht, agency zu entwickeln und ihren Platz in der hoch stratifizierten südafrikanischen Gesellschaft mitzubestimmen
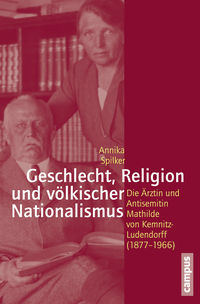
Geschlecht, Religion und völkischer Nationalismus
Die Ärztin und Antisemitin Mathilde von Kemnitz-Ludendorff (1877-1966)
Annika Spilker, Campus Verlag, 2013, S. 447, 49,90€, ISBN 978-3-5933-9987-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Ärztin, Frauenrechtlerin und antisemitische Theoretikerin Mathilde von Kemnitz-Ludendorff war eine der umstrittensten Figuren der Weimarer Republik. Gemeinsam mit ihrem dritten Ehemann, dem General und Politiker Erich Ludendorff, führte sie den nationalistischen "Tannenbergbund" und gründete den völkisch-religiösen Verein "Deutschvolk", von dem noch heute Nachfolgeorganisationen bestehen. Die Autorin analysiert die komplexen Kommunikationszusammenhänge, in denen Mathilde von Kemnitz-Ludendorff ihre radikalen Erneuerungs- und Erlösungskonzepte bis in die frühen 1930er- Jahre entwickelte. Dabei werden sowohl der medizinhistorische Kontext als auch die Bezüge zur Frauenbewegung in einer kultur- und geschlechtergeschichtlichen Zusammenschau berücksichtigt.
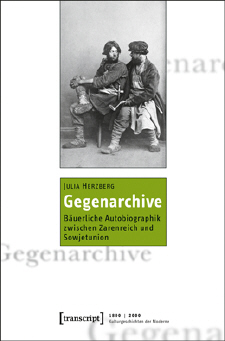
Gegenarchive
Bäuerliche Autobiographik zwischen Zarenreich und Sowjetunion
Julia Herzberg, transcript Verlag, 2013, S. 496 43,99€, ISBN 978-3-8376-2136-5
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Gewalttätig, naiv und stumm – nach der Aufhebung der Leibeigenschaft 1861 galt diese Charakterisierung des russischen Bauern nicht mehr. Der Bauer wurde zum Symbol für eine in Bewegung geratene Gesellschaft. In Autobiographien und Tagebüchern erzählten Bauern ihre Leben als Sklaven, Autodidakten oder religiös Erweckte und eroberten eine Leserschaft, die in diesen Texten neben dem vermeintlich ›echten‹ Bauern auch alternative Gesellschaftsentwürfe fand. Julia Herzberg analysiert Entstehungssituationen, Publikation und Überlieferung dieser einzigartigen Quellen bis zur Kollektivierung der 1930er Jahre, die mit der bäuerlichen Autonomie auch das Erzählen über das eigene Leben erstickte.
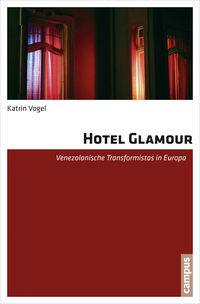
Hotel Glamour
Venezolanische Transformistas in Europa
Katrin Vogel, Campus Verlag, 2013, S. 316, 39,90€, ISBN 978-3-5933-9963-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Trans, Prostituierte, Migrantinnen ohne geregelten Aufenthaltsstatus - das Leben venezolanischer Transformistas in Europa verläuft in einer körperlichen, legalen und räumlichen Grauzone. Transformistas verstehen sich als männlich Geborene, die ihre Körper zu hyperfemininer Schönheit formen, weil sie Männer begehren. Ihren Traum von Europa, vom großen Geld und Hedonismus verwirklichen sie, indem sie die Nachfrage nach Transprostituierten auf dem europäischen Sexmarkt bedienen. Im "Hotel Glamour" in Barcelona hat Katrin Vogel den Alltag der Transformistas jenseits des Straßenstrichs geteilt. Entstanden ist die Ethnografie einer Lebenswelt, die sich zwischen dem prekären "Hier und Jetzt" in Europa und dem Wunsch nach einem Eigenheim an der Karibikküste Venezuelas aufspannt.
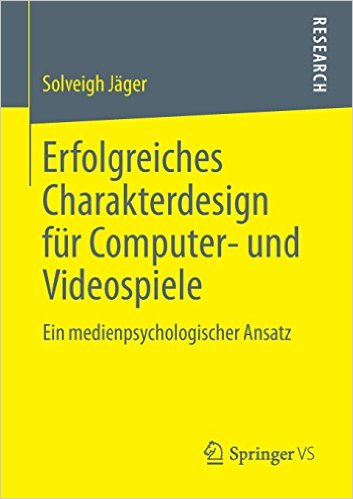
Erfolgreiches Charakterdesign für Computer- und Videospiele
Solveigh Jäger, Springer V.S., 2013, S. 284, 39,99€, ISBN 978-3-6580-2625-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Computerspiele sind ein rasant wachsendes Massenmedium, das unsere Kultur und Gesellschaft heute entscheidend prägt und beeinflusst. Die Analyse virtueller Spielfiguren und die Auseinandersetzung mit ihrer Bedeutung sind aber bislang wenig erforscht, obwohl Charaktere zu den Schlüsselkomponenten von Spielen gehören. Solveigh Jäger gibt einen umfassenden Einblick in die komplexe Welt der digitalen Spielfigur, als interaktives Pixelbild und verbindenden, realen Bestandteil unserer Kultur und Gesellschaft. Sie zeigt, dass ein erfolgreiches Charakter-Design ein medienpsychologisches Verständnis über den Spieler als Rezipienten voraussetzt. Die Grundregeln des menschlichen Verhaltens wirken sich direkt auf den virtuellen Repräsentanten in der digitalen Welt aus und beeinflussen die Wahrnehmung des Spielers in Abhängigkeit von seinem Typus, Geschlecht und dessen Kultur.
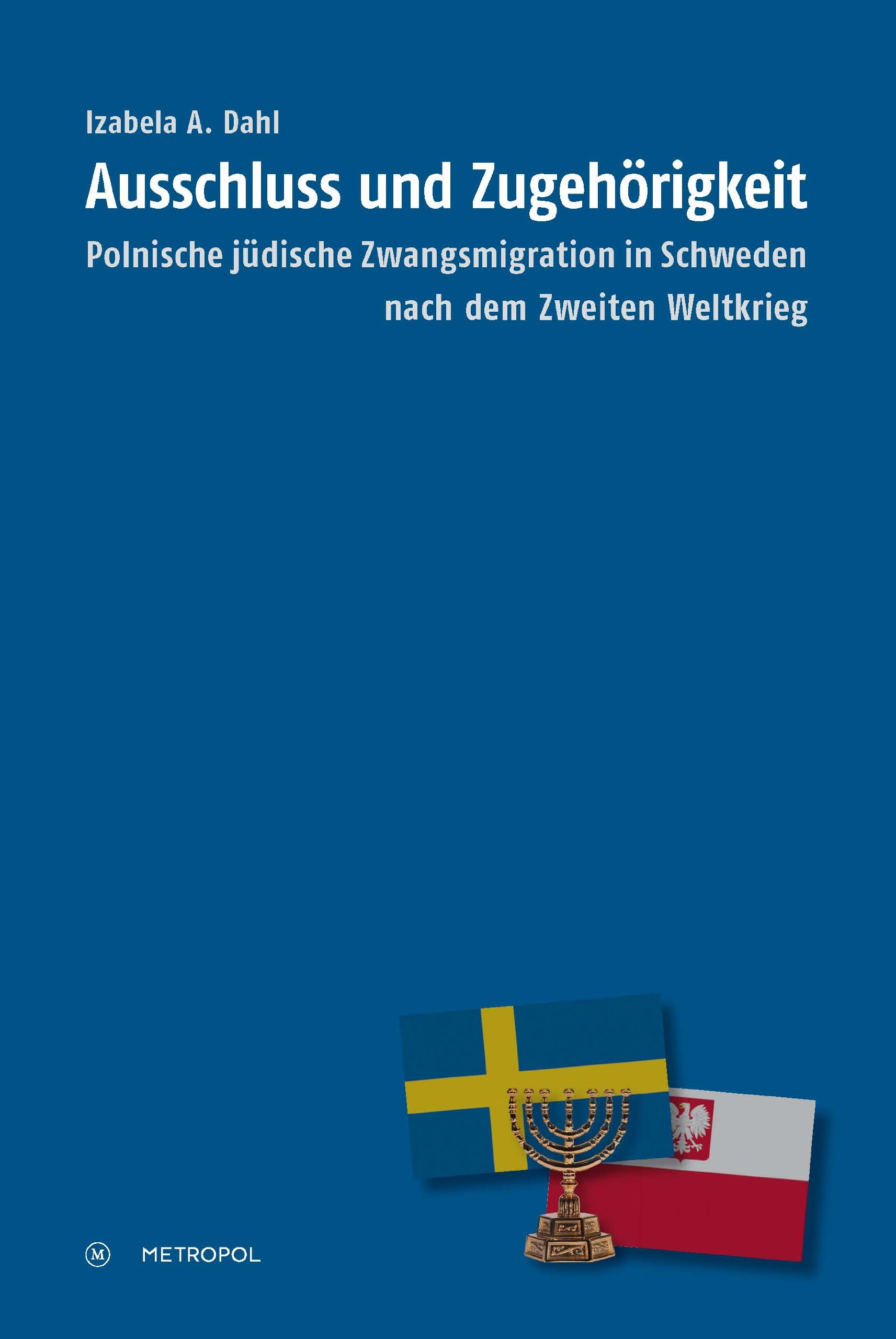
Ausschluss und Zugehörigkeit
Polnische jüdische Zwangsmigration in Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg
Izabela A. Dahl, Metropol-Verlag, 2013, S. 406, 29,90€, ISBN 978-3-8633-1108-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Nach dem Zweiten Weltkrieg und noch einmal forciert durch die antisemitische Kampagne 1968 in Polen verließen viele Jüd_innen das Land. Ein wichtiges Aufnahmeland war Schweden. Izabela A. Dahl analysiert in ihrer historisch-kulturwissenschaftlichen Studie die politischen und kulturellen Verhältnisse der Jahre 1945–1946 und 1968–1972 im Herkunfts- wie auch im Aufnahmeland. Im Zentrum der Arbeit stehen die Identitätskonstruktionen der polnischen jüdischen Zwangsmigrant_innen im Schweden der Nachkriegszeit und die Frage, inwiefern die jeweiligen historischen Umstände die Konstruktion von Identität beeinflussen und verändern. Dabei untersucht die Autorin, wie der historische Kontext, der zur Migration der polnischen Jüd_innen geführt hat, in der Forschung, in den Medien und in den Institutionen verhandelt wird. Die Studie basiert auf umfangreichen Archiv- und Presserecherchen sowie Interviews mit Zwangsmigrierten und gibt neue Einblicke in polnisch-jüdische, schwedisch-jüdische und schwedisch-polnische Beziehungen nach 1945.
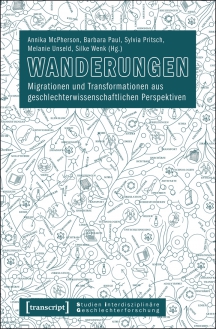
Wanderungen
Migrationen und Transformationen aus geschlechterwissenschaftlichen Perspektiven
Annika McPherson, Barbara Paul, Sylvia Pritsch, Melanie Unseld, Silke Wenk (Hrsg.), transcript Verlag, 2013, S. 240, 28,80€, ISBN 978-3-8376-2220-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Menschen, Dinge und Konzepte sind weltweit in Bewegung geraten. Welche Effekte haben diese vielfältigen Wanderungsbewegungen zwischen Kulturen und Disziplinen auf politisches Handeln und auf die wissenschaftliche Praxis? Wie lassen sich die unterschiedlichen Migrations- und Transformationsprozesse in Bezug auf Geschlechterverhältnisse analysieren? Die inter- und transdiziplinären Beiträge dieses Bandes (aus Kultur-, Sozial-, Politik- und Rechtswissenschaften) nehmen nicht nur die Migration von Menschen, sondern auch die von kulturellen Artefakten sowie von Ideen und Konzepten in den geschlechterwissenschaftlichen Blick.
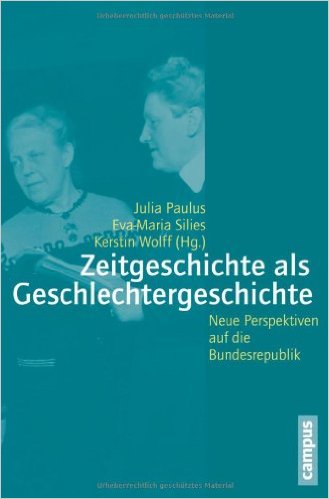
Zeitgeschichte als Geschlechtergeschichte
Neue Perspektiven auf die Bundesrepublik
Julia Paulus, Eva-Maria Silies, Kerstin Wolff (Hrsg.), in der Reihe Geschichte und Geschlechter erschienen, Campus Verlag, 2012, S. 336, 39,90€, ISBN 978-3-5933-9742-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In der Zeitgeschichte herrscht die These einer fortschreitenden Emanzipation der Frauen seit den 1950er-Jahren vor. Bei genauerer Betrachtung ergibt sich freilich ein anderes Bild. Anhand von Themenfeldern wie »Beruf und Familie«, »Sexualitäten und Körper« und »Partizipation und Protest« wird in diesem Band die Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik einer geschlechterhistorischen Analyse unterzogen. Dabei wird deutlich, dass sich gesellschaftlich tief verwurzelte Vorstellungen zu den Geschlechterrollen nur langsam verändern - egal, ob in Zeiten der Stagnation oder eines dynamischen Wandels.
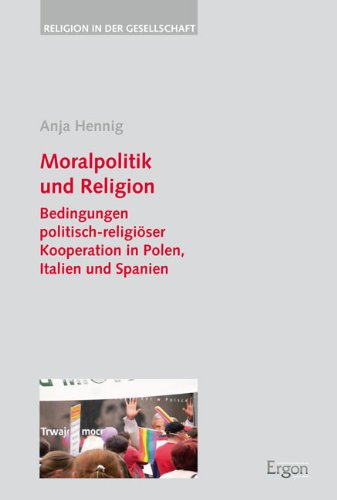
Moralpolitik und Religion
Bedingungen politisch-religiöser Kooperation in Polen, Italien und Spanien
Anja Hennig, Ergon Verlag, 2012, S. 473, 30€, ISBN 978-3-8991-3912-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Moralpolitik ist ein konfliktreiches Feld, in dem unvereinbare Wertvorstellungen aufeinander prallen. Beispielhaft sind die hier untersuchten Debatten um die rechtliche Regelung von Schwangerschaftsabbrüchen und künstlicher Befruchtung sowie um die Anerkennung homosexueller Partnerschaften; sensible Themen, zu denen die katholische Kirche eindeutig Position bezieht. Daher provozierten Forderungen nach einer liberalen Handhabe insbesondere in katholischen Ländern während der letzten zwanzig Jahre heftige Kontroversen. Moralpolitik ist daher auch ein Feld, in dem Religion und Politik besonders sichtbar aneinander geraten, oder sich - wie dieses Buch zeigt - gegenseitig stützen. Eingebettet in die säkularisierungskritische Diskussion legt das Buch eine vergleichende Analyse der genannten moralpolitischen Konflikte in Polen, Italien und Spanien zwischen 1990 und 2010 vor. Die Autorin geht der Frage nach, weshalb sich diese katholischen Länder in ihrer moralpolitischen Gesetzgebung unterscheiden: Warum setzte sich in Spanien die "Homo-Ehe" sowie eine liberale Handhabe von Abtreibung durch? In Polen und Italien waren hingegen jene erfolgreich, die eine politische Anerkennung homosexueller Paare ablehnten und die reproduktiven Rechte von Frauen einschränkten. Zur Klärung dieser Frage untersucht die Autorin das jeweilige Zusammenspiel bestimmter Facetten von Religion und Politik im Verlauf der Konflikte. Ihre Ergebnisse weisen dabei deutlich über die Länderstudien hinaus.
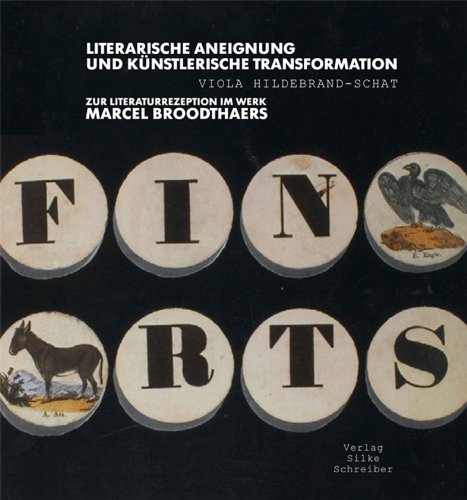
Literarische Aneignung und künstlerische Transformation
Zur Literaturrezeption im Werk von Marcel Broodthaers
Viola Hildeberand-Schat, Schreiber Verlag, 2012, S. 368, 49€, ISBN 978-3-8896-0127-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
„Der vorliegenden Untersuchung ist die Bereitschaft des Lesers zu wünschen, den in Broodthaers’ Œuvre angelegten beweglichen Fluchtlinien und Strömungen nachzuspüren, insbesondere denjenigen, in die er Literatur und bildende Kunst, Geschichte und Gegenwart, Theorie und Praxis hineinzuziehen verstand. Dafür liefert dieses Buch die vielfältigsten Ansatzpunkte und Querverweise.“
Gregor Stemmrich
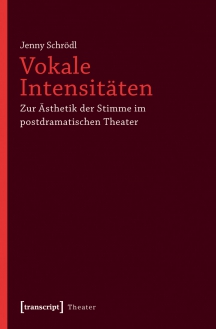
Vokale Intensitäten
Zur Ästhetik der Stimme im postdramatischen Theater
Jenny Schrödl, transcript Verlag, 2012, S. 318, 35,80€, ISBN 978-3-8376-1851-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Theaterstimmen faszinieren. Wenn auf der Bühne lauthals geschrien, exzessiv geflüstert oder chorisch gesprochen wird, dann erhalten Stimmen eine auffällige Präsenz im Raum und rufen beim Publikum starke sinnlich-affektive Eindrücke hervor. Im Zentrum dieses Buches, das durch eine CD-ROM mit Theaterszenen ergänzt wird, stehen solche Situationen vokaler Intensität. Anhand zahlreicher Beispiele (u.a. Castorf, Gotscheff, Perceval, Pollesch, Schleef) wird die Sprechstimme im postdramatischen Theater hinsichtlich Materialität, ästhetischer Erfahrung und Ko-Präsenz analysiert und damit erstmals systematisch in Bezug auf ihre besondere Ästhetik untersucht. Die Studie liefert dadurch einen grundlegenden Beitrag zur Aufführungstheorie und -analyse sowie zur Stimm- und Performativitätsforschung.
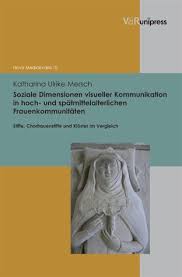
Soziale Dimensionen visueller Kommunikation in hoch- und spätmittelalterlichen Frauenkommunitäten
Stifte, Chorfrauenstifte und Klöster im Vergleich
Katharina Ulrike Mersch, V&R unipress, 2012, S.514, 80€, ISBN 978-3-89971-930-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Inwiefern prägte die Ordenszugehörigkeit den Werthorizont mittelalterlicher Frauenkommunitäten? Diese Frage diskutiert Katharina Ulrike Mersch aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive anhand von Zeugnissen visueller Kommunikation. Auf Basis von Luhmanns Systemtheorie entwickelt sie eine kommunikationshistorische Methode der Bildinterpretation. Diese ermöglicht, die Beziehungen der Frauenkommunitäten zur Kirche, den Orden, anderen Konventen sowie zur laikalen Bevölkerung in einer komparativen Langzeitstudie gegeneinander abzuwägen. Um einen Beitrag zur Ordensforschung zu leisten, werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten behandelt, die sich dabei in den verschiedenen kanonikalen und monastischen Lebensentwürfen ergeben. In dieser Hinsicht erweisen sich fünf Themenkomplexe – Wissensvermittlung, Osterkult, Eucharistiedevotion, weltliche Bildinhalte und Medien der Kontemplation – als besonders aussagekräftig und werden bevorzugt behandelt.
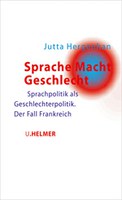
Sprache Macht Geschlecht
Sprachpolitik als Geschlechterpolitik. Der Fall Frankreich
Jutta Hergenhan, Ulrike Helmer Verlag, 2012, S. 278, 29,95€, ISBN 978-3-8974-1345-0
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Jutta Hergenhan zeigt auf, dass die Geschlechterungleichstellung in der französischen Sprache ein historisches Phänomen ist, das seinen Ursprung in der Frühen Neuzeit nahm. In der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts stellten sich gleichzeitig auch die Weichen für eine spätere Geschlechtertrennung in der Politik, wobei sprachliche Entwicklungen keine unbedeutende Rolle spielten. Die heutige französische Gleichstellungspolitik zielt auf Parität der Geschlechter in Politik und Sprache. Dabei gibt es jedoch unterschiedliche Wege, wie der Vergleich mit den französischsprachigen Landesteilen Kanadas, Belgiens und der Schweiz zeigt.
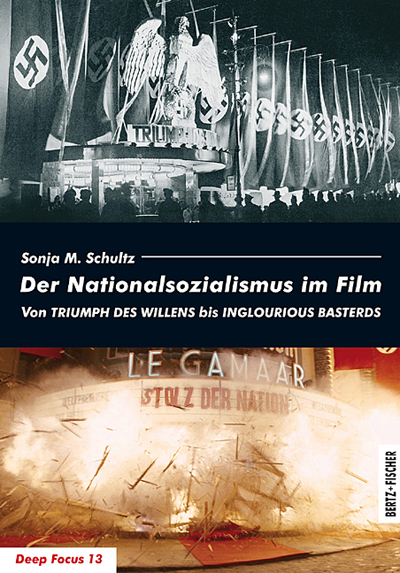
Der Nationalsozialismus im Film
Von Trimp des Willens bis Inglourious Basterds
Sonja M. Schultz, Bertz + Fischer Verlag, 2012, S. 560, 29€, ISBN 978-3-8650-5314-5
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Das Kino war ein entscheidender Ort nationalsozialistischer Selbstdarstellung, und der Film hat sich seit den faschistischen Propaganda-Bildern unablässig mit dem Nationalsozialismus befasst: mit den Nazis und Hitler, mit dem Holocaust, dem Vernichtungskrieg, mit Widerstand und Befreiung. Wieder und wieder wird die Vergangenheit, die sich nicht bewältigen lässt, inszeniert: in Spielfilmen, Satiren, Dokumentarfilmen, als Holocaust-Drama, Science-Fiction, Trashfilm oder Doku-Soap, im Kino, im Fernsehen und im Internet.
Sonja M. Schultz wagt eine Gesamtschau von über 80 Jahren NS im Film, von den 1930ern bis heute. Wie ändern sich die Bilder durch die Jahrzehnte, wie unterscheiden sie sich etwa in den USA, Deutschland, Osteuropa oder Israel? Und wie sind sie verzahnt mit den zeitgeschichtlichen Diskussionen um Täterschaft und Verleugnung, Erinnerung und Opfergruppen, nationale Selbstdefinition und staatliche Geschichtspolitik?

Weltnaturschutz
Umweltdiplomatie in Völkerbund und Vereinten Nationen 1920-1950
Anna-Katharina Wöbse, Campus Verlag, 2012, S. 364, 39,90€, ISBN 978-3-5933-9434-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Als der Völkerbund 1920 in Genf seine Tätigkeit aufnahm, stand auch der Naturschutz auf der Tagesordnung. Probleme wie die Meeresverschmutzung durch Öl erforderten internationale Verhandlungen, der Planet Erde wurde als fragiler Gemeinschaftsraum sichtbar. Anna-Katharina Wöbse stellt die Debatten zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren und hoher Diplomatie dar und legt offen, dass daraus neben der Idee des »Weltnaturerbes« auch zahlreiche bis heute gültige Schutzabkommen hervorgingen.
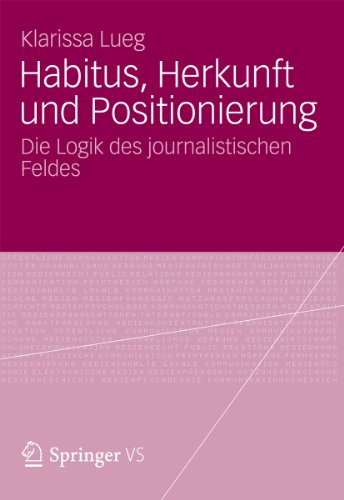
Habitus, Herkunft und Positionierung
Die Logik des Journalistischen Feldes
Klarissa Lueg, Springer V.S., 2012, S. 264, 32,99€, ISBN 978-3-5311-9569-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Klarissa Lueg geht der Frage nach dem Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und der Hierarchie im journalistischen Feld nach. Dabei wird grundsätzlich die Herkunft von ChefredakteurInnen und JournalistenschülerInnen und die Bedeutung dieser sozialen Herkunft für Berufszugang und Positionierungsstrategien erläutert. Es wird deutlich, dass nicht nur die Karrierewege der untersuchten Gruppen selbst ein herkunftsspezifisches Muster aufweisen, sondern dass auch die Verteilung und Zuweisung von Macht im journalistischen Feld eng mit der Herkunft ihrer TrägerInnen verbunden ist.
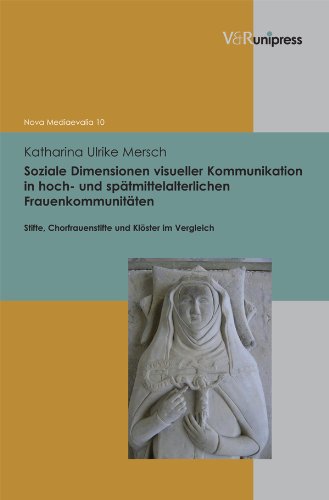
Soziale Dimensionen visueller Kommunikation in hoch- und spätmittelalterlichen Frauenkommunitäten
Stifte, Chorfrauenstifte und Klöster im Vergleich
Katharina Ulrike Mersch, V&R Unipress, 2012, S. 514, 79,99€, ISBN 978-3-8997-1930-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Inwiefern prägte die Ordenszugehörigkeit den Werthorizont mittelalterlicher Frauenkommunitäten? Diese Frage diskutiert Katharina Ulrike Mersch aus geschichtswissenschaftlicher Perspektive anhand von Zeugnissen visueller Kommunikation. Auf Basis von Luhmanns Systemtheorie entwickelt sie eine kommunikationshistorische Methode der Bildinterpretation. Diese ermöglicht, die Beziehungen der Frauenkommunitäten zur Kirche, den Orden, anderen Konventen sowie zur laikalen Bevölkerung in einer komparativen Langzeitstudie gegeneinander abzuwägen. Um einen Beitrag zur Ordensforschung zu leisten, werden die Unterschiede und Gemeinsamkeiten behandelt, die sich dabei in den verschiedenen kanonikalen und monastischen Lebensentwürfen ergeben. In dieser Hinsicht erweisen sich fünf Themenkomplexe Wissensvermittlung, Osterkult, Eucharistiedevotion, weltliche Bildinhalte und Medien der Kontemplation als besonders aussagekräftig und werden bevorzugt behandelt.
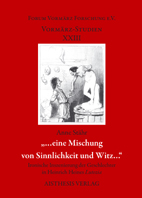
„…eine Mischung von Sinnlichkeit und Witz…“
Ironische Inszenierung der Geschlechter in Heinrich Heines „Lutezia“
Anne Stähr, Aisthesis Verlag, 2012, S. 236, 29,80€, ISBN 978-3-8952-8922-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Heinrich Heines Lutezia ist erst in der jüngeren Heine-Forschung wieder in den literaturwissenschaftlichen Fokus gerückt. Die Untersuchung der Ironie in Heines Texten stellt dagegen eine langjährige Forschungstradition dar. Worin aber besteht die Funktion des Ironischen für die Geschlechterinszenierungen bei Heine? Und welche Bezüge zum (Wissens-)Diskurs über Geschlecht in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts stellt Heines Feuilleton her? Anne Stähr nimmt diese Schnittstellen in den Blick und macht die Kategorie ‚Gender‘ für die Lutezia produktiv.
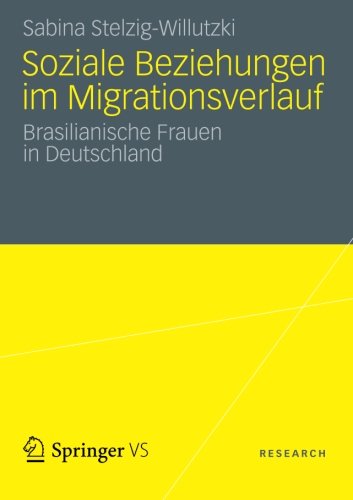
Soziale Beziehungen im Migrationsverlauf
Brasilianische Frauen in Deutschland
Sabina Stelzig-Willutzki, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2012, S. 276, 42,99€, ISBN 978-3-5311-8572-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Sabina Stelzig-Willutzki untersucht den Einfluss sozialer Beziehungen auf die eigenständige Migration von Frauen am Beispiel von Brasilianerinnen in Deutschland. Sowohl die Bedeutung der Kontakte zu anderen brasilianischen Migranten und Migrantinnen, als auch die Kontakte zu Personen und (binationalen) Netzwerken im Zielland der Migration werden analysiert. Die Autorin zeigt, dass soziale Beziehungen Migrationsverläufe nicht nur durch Informationen und instrumentelle Hilfen beeinflussen können, sondern auch durch Prozesse ethnischer Stereotypisierungen.
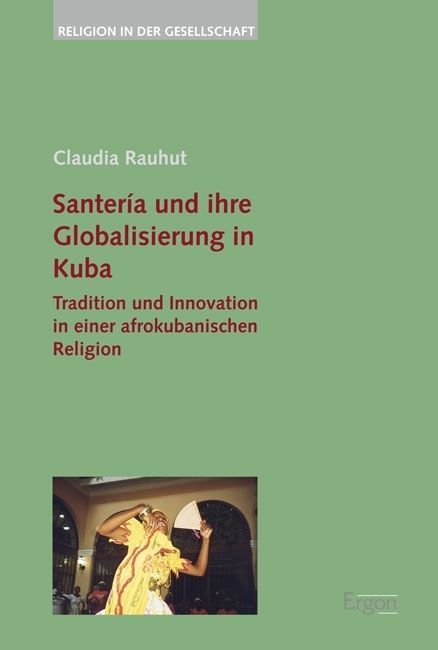
Santería und ihre Globalisierung in Kuba
Tradition und Innovation in einer afrokubanischen Religion
Claudia Rauhut, Egon Verlag, 2012, S. 340, 42€, ISBN 978-3-8991-3946-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Dissertation untersucht Akteur/innen, Praktiken und Konfliktfelder der transnationalen Vernetzung der afrokubanischen Religion Santería. Entstanden aus dem religiösen Erbe westafrikanischer Sklaven/innen und des iberisch-kolonialen Katholizismus ist sie heute die populärste Religion in Kuba. Durch kubanische Migrant/innen, globale Kulturindustrien und Tourismus gelangte die Santería in die USA, die Karibik, nach Lateinamerika und Europa. Die lokale Religionspraxis vollzieht sich seit den 1990er Jahren zunehmend in nationen- und grenzüberschreitenden Räumen und wird durch reziproke Verpflichtungen innerhalb transnationaler Ritualfamilien gestützt. Claudia Rauhut hat basierend auf qualitativen Feldforschungen zwischen 2004 und 2007 in Havanna die Neuverhandlung von Macht, Tradition und Innovation im transnationalen religiösen Feld Kubas analysiert. Sie arbeitet historische, soziale, ökonomische und politische Faktoren der Transnationalisierung der Santería und ihre Konfliktfelder heraus. Diese behandeln Deutungskämpfe um die Ausrichtung der Ritualpraxis, um religiöse Institutionalisierung und ethische Normierung, um widerstreitende Traditionsbezüge zwischen Kuba und Afrika, neue Geschlechterrollen sowie veränderte Beziehungen zwischen afrokubanischen Religionen und katholischer Kirche. Santería-Praktizierende Kubas und ihr Expertenkampf zielen auf die Kontrolle eines unausweichlichen Religionswandels in einem globalisierten Setting ab. Darin geht es um Teilhabe und Integration in globale religiöse Entwicklungen einerseits und Selbstbehauptung einer Souveränität im lokalen Religionshandeln andererseits.
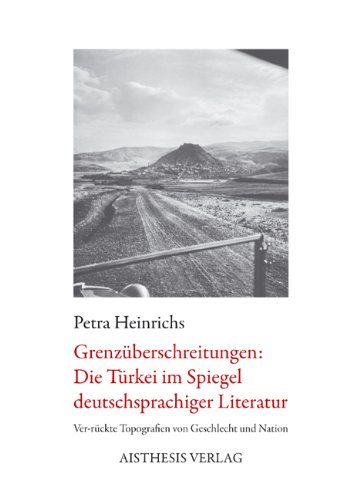
Grenzüberschreitungen: Die Türkei im Spiegel deutschsprachiger Literatur
Ver-rückte Topografien von Geschlecht und Nation
Petra Heinrichs, Aisthesis Verlag, 2011, S. 462, 39,80€, ISBN 978-3-8952-8860-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Gefragt wird in der vorliegenden Studie nach literarischen Strategien, die die Türkei als territorialen Bezugsraum inszenieren. In der abendländischen Geistesgeschichte markiert sie eine Grenze zwischen Europa und Asien und zugleich die Unmöglichkeit, kategoriale Grenzverläufe wie die zwischen Okzident und Orient, Eigenem und Fremdem/Anderem eindeutig zu ziehen. Innerhalb dieser Unterscheidungsmodelle reflektiert jede Rede vom Einen/Eigenen notwendig ein/etwas Anderes. Diese Spiegelung durchzieht die hinsichtlich des Entstehungszeitraumes, des Genres und der thematischen Ausrichtung äußerst unterschiedlichen Texte und Filme. Die Textauswahl beginnt bei der weiblichen Orientreiseliteratur des 19. Jahrhunderts und mündet in der polyphonen Vielfalt der Gegenwartsliteratur. Durch die Rekonstruktion kultureller Repräsentationssysteme und die Analyse darin Verwendung findender Schreibverfahren von Unterwerfung, Verwerfung und Subversion werden Ver-rückungen sichtbar und neue Räume der Interpretation eröffnet.
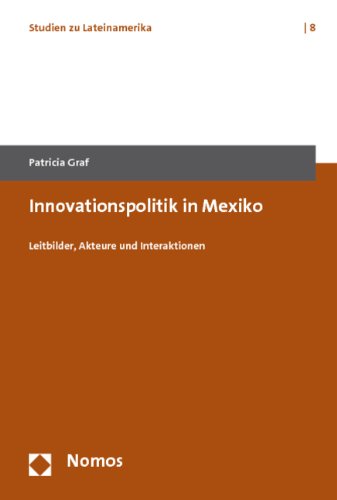
Innovationspolitik in Mexiko
Leitbilder, Akteure und Interaktionen
Patricia Graf, Nomos Verlag, 2011, S. 312, 54€, ISBN 978-3-8329-6159-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Einerseits hat Mexiko interessante und innovative Instrumente zur Förderung von Unternehmensgründungen, Industrieforschung sowie public-private partnerships eingeführt. Andererseits ist die Unternehmensproduktivität gering und Lernprozesse finden vor allem auf der Basis von im Ausland erworbenem Wissen und damit innerhalb des engen Rahmens von Lizenzverträgen statt. Der vorliegende Band untersucht, inwiefern diese Schwächen auch den politischen Strukturen in der mexikanischen Innovationspolitik geschuldet sind. In zwei Fallstudien zu Innovationsclustern in den Staaten Jalisco und Guanajuato wird gezeigt, dass die Politikverflechtung im Politikfeld Innovation sowohl die Möglichkeiten zur Kooperation als auch zur Blockade bietet. Der Band leistet damit auch einen theoretischen Beitrag zur politikwissenschaftlichen Innovationsforschung.
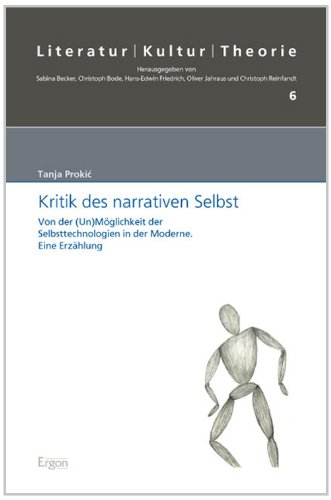
Kritik des narrativen Selbst
Von der (Un)Möglichkeit der Selbsttechnologien in der Moderne. Eine Erzählung
Tanja Prokic, als Band 6 in der Reihe Literatur, Kultur, Theorie erschienen, Ergon Verlag, 2011, S. 260, 39€, ISBN 978-3-8991-3844-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Das Selbst steht heute ohne Frage im Mittelpunkt sämtlicher Reflexionen: da lautet es, man solle sich auf sich ‚selbst' besinnen, seine Beziehung zu sich ‚selbst' pflegen, ‚Selbst'verantwortung übernehmen, oder gar der Manager seiner ‚Selbst' werden. Soziale Netzwerke, Lebenslauf, Krankenakten, Fingerabdrücke, DNS-Datenbanken etc. rücken das Selbst in den Fokus des Interesses. Allen gleichermaßen unterliegt ein unüberhörbarer Imperativ, der von uns verlangt, Individuum zu sein und uns als solches narrativ über eine Lebensgeschichte verfügbar zu machen. Was aber heißt es, Individuum zu sein? Warum brauchen wir eine Lebensgeschichte? Warum müssen wir uns unentwegt mit uns selbst beschäftigen? Wie aus dem Zirkel der Selbstthematisierung aussteigen? Als ein praxisfähiger Umgang mit dem Aufruf zur Selbstbeschäftigung wurden zahlreich von der Rezeption Michel Foucaults Untersuchungen zu den Technologien des Selbst ("Formen, in denen das Individuum auf sich selbst einwirkt und sich selbst zum Kunstwerk macht") erörtert. Eine analytische Korrelation sozialer Zeitverhältnisse im Anschluss an Niklas Luhmann und Armin Nassehi mit den dadurch erwachsenden Anforderungen an das Individuum legt die Technologien des Selbst jedoch als ein gesellschaftliches Funktionserfordernis offen, das sich im Zuge medialer Revolutionen und damit korrelierender gesellschaftsstruktureller Umwälzungen sehr schnell und unter den Füßen der Individuen zu ändern vermag.
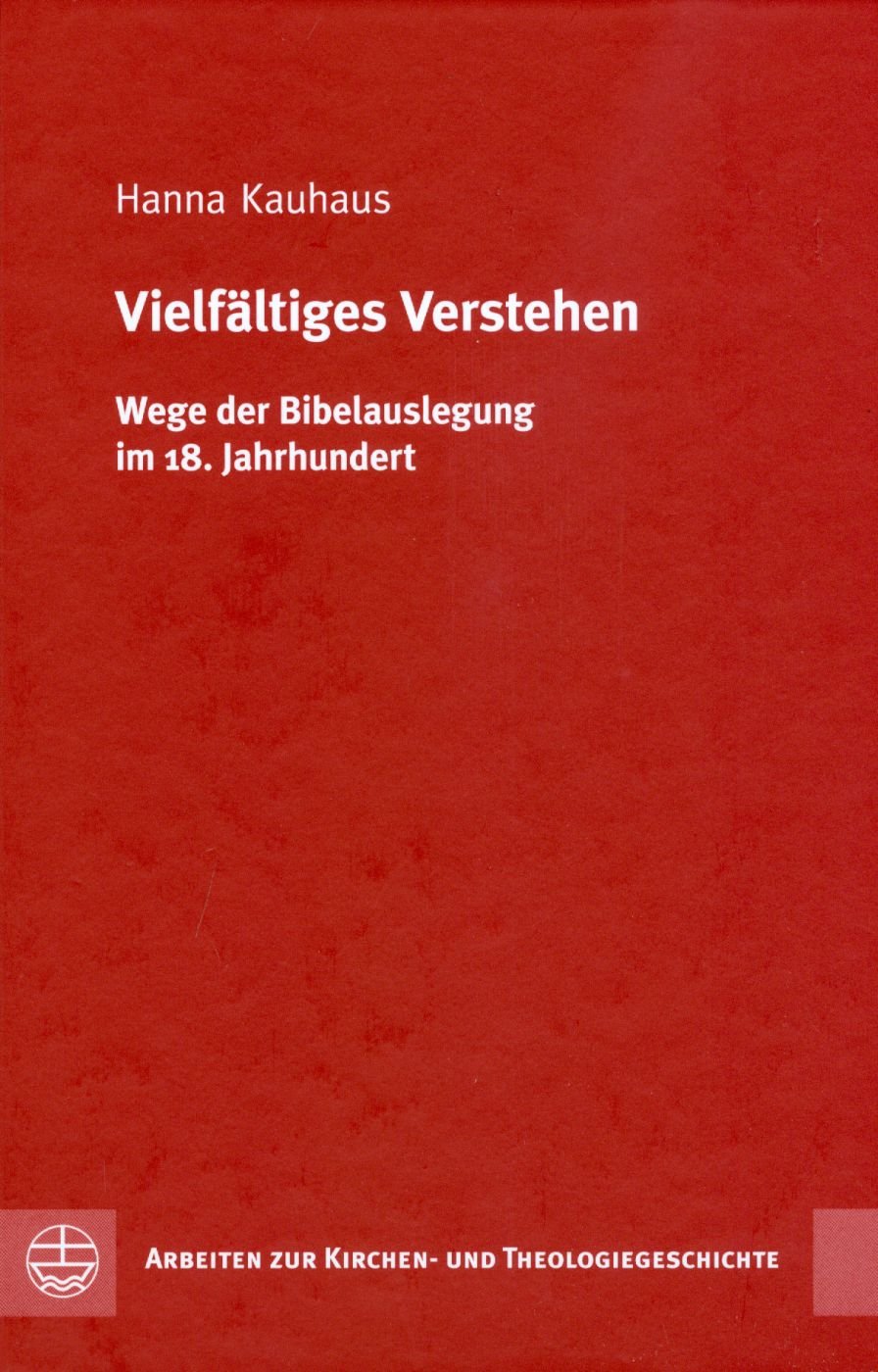
Vielfältiges Verstehen
Wege der Bibelauslegung im 18. Jahrhundert
Hanna Kauhaus, Evangelische Verlagsanstalt , 2011, S. 352, 38€, ISBN 978-3-3740-2886-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Im Zeitalter der Aufklärung vollziehen sich in Bibelwissenschaft und Exegese wesentliche Umbrüche. Dass die aber nicht geradlinig auf die Entstehung historisch-kritischer Bibelauslegung zulaufen, zeigt diese Studie. In einem exemplarischen Querschnitt untersucht Hanna Kauhaus 27 Auslegungstexte auf den methodischen Umgang der Autoren mit dem jeweiligen Bibeltext und auf dessen implizite theologische und philosophische Voraussetzungen. Um die beiden Königsberger Immanuel Kant und Johann Georg Hamann wird ein geistiges Cluster konstruiert, zu dem neben wenig bekannten Theologen aus dem lokalen Umfeld auch Sigmund Jacob Baumgarten, Johann David Michaelis, Johann Caspar Lavater und Edward Young gehören. Analyse und Vergleich der Beispiele zeigen, wie sich die Auslegungen durch ihr Verhältnis zu den Parametern Sprache, Geschichte, Dogmatik, Philosophie und Erfahrung charakterisieren lassen. Die Autorin wurde 2010 mit dieser Arbeit im Fach Kirchengeschichte an der Theologischen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universtät Jena promoviert.
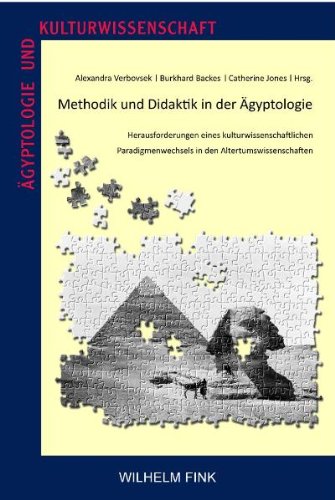
Methodik und Didaktik in der Ägyptologie
Herausforderungen eines kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsels in den Altertumswissenschaften
Alexandra Verbovsek, Burkhard Backes, Catherine Jones (Hrsg.), Wilhelm Fink Verlag, 2011, S. 783, 132€, ISBN 978-3-7705-5185-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Für die ägyptologische Methodik und Didaktik stellt der gegenwärtige kulturwissenschaftliche Paradigmenwechsel eine besondere Herausforderung dar. In 38 Beiträgen werden die vielfältigen epistemologischen Schwierigkeiten, aber auch die Chancen diskutiert, die sich aus dem kulturwissenschaftlichen Paradigmenwechsel ergeben. Aus dem Gespräch von Ägyptologie, Kultur-, Geschichts- und Religionswissenschaft, Linguistik, Archäologie und Museologie ergeben sich neue Perspektiven. Nicht zuletzt gelingt es den Beiträgen Impulse für die Entwicklung fachübergreifender Fragestellungen der verschiedensten kulturwissenschaftlichen Diskurse zu geben.
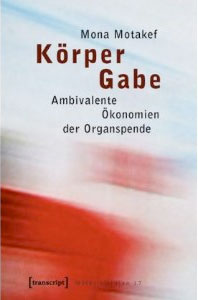
Körper Gabe
Ambivalente Ökonomien der Organspende
Mona Motakef, transcript Verlag, 2011, S. 268, 29,80€, ISBN 978-3-8376-1631-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Obwohl bei einer Organspende dem Körper Teile entnommen werden, gilt sie nicht als Tabu, sondern vielmehr als Inbegriff einer guten Tat. Medizin und Bioethik diagnostizieren, dass es von diesen guten Taten zu wenige gibt und diskutieren, wie der Organmangel überwunden werden kann. Mona Motakef entreißt dieser Perspektive jene Selbstverständlichkeit, die nur nach Optimierung fragt. Im Rückgriff auf das soziologische Instrumentarium aus Gouvernementalitäts-, Körper- und Gabenforschung rekonstruiert sie, wie die Verfügbarkeit von Körpern und die Veräußerbarkeit von Subjekten im biopolitischen Diskurs der Organspende verhandelt wird.
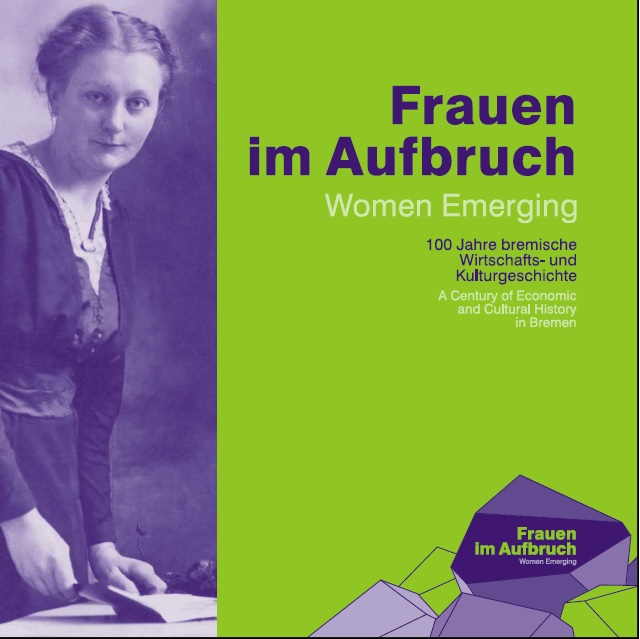
Frauen im Aufbruch
100 Jahre bremische Wirtschafts- und Kulturgeschichte
Andrea Buchelt (Hrsg.), Kellner Verlag, 2011, S. 128, 10€, ISBN 978-3-9399-2860-7
Das Buch kann für 10€ plus Versandkosten bei der Autorin bestellt werden. (Kontakt: Andrea Buchelt, Elsasser Str. 1, 28211 Bremen oder via Mail)
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
„Frauen im Aufbruch“ schildert das Leben von 24 Frauen aus Bremen, Bremerhaven und dem niedersächsischen Umland.
Ihr Werdegang skizziert ein gutes Jahrhundert deutscher Geschichte aus der Perspektive aktiver, engagierter Frauen aus dem Nordwesten.
Unter den Protagonistinnen finden sich Namen wie Louise Ebert, die die Rolle der First Lady für ihre Nachfolgerinnen definierte; Lale Andersen, die mit „Lili Marleen“ Fronten überbrückte und Clara Rilke-Westhoff, die als Pionierin der Bildhauerei gilt.
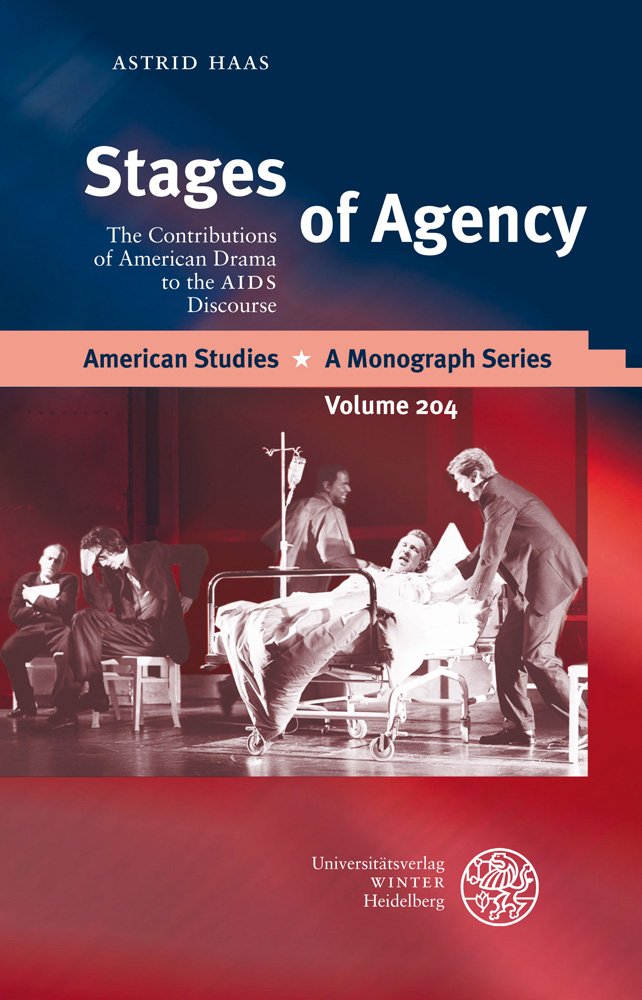
Stages of Agency
The Contributions of American Drama to the AIDS Discourse
Astrid Haas, Universitätsverlag Winter, 2011, S. 334, 38€, ISBN 978-3-8253-5873-0
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
'Stages of Agency' is the first monograph to analyze the contributions of American stage drama to the discourse on AIDS in the United States from the mid-1980s through the late 1990s. This discourse provides a telling example of how the arts can become agents in socio-political debates. As the study shows, theater and drama played a unique role in educating the American public about AIDS, offering support for the sick and the grieving, and intervening in the mainstream societal perceptions and representations of the epidemic. Taking some of the best-known American AIDS plays as exemplary case studies, 'Stages of Agency' maps the diachronic development of this body of work in its increasing thematic, formal, and identity political heterogeneity. The study analyzes the strategies these plays employed to blend art with activism in order to establish a counter-discourse to the mainstream public debate about AIDS and provide social agency to the affected populations.
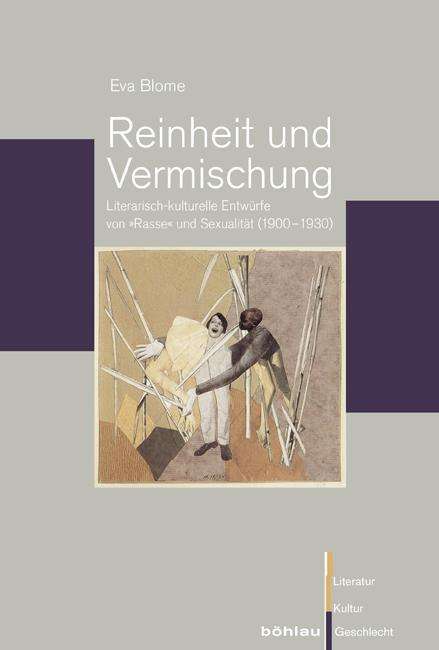
Reinheit und Vermischung
Literarisch-kulturelle Entwürfe von "Rasse" und Sexualität (1900-1930)
Eva Blome, Böhlau Verlag, 2011, S. 330, 44,90€, ISBN 978-3-4122-0682-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Eva Blome setzt sich in ihrer umfassenden Dissertation erstmalig aus literaturwissenschaftlicher Perspektive mit den interdiskursiven Transformationen des Themas ‚Rassenmischung‘ im deutschen kolonialen Kontext auseinander. Die Autorin nimmt den Einsatz der ‚Rassenmischung‘ als biopolitische und poetologische Argumentationsfigur in den Fokus, indem sie die deutschsprachige Kolonialliteratur um 1900 und die Kunst und Literatur des europäischen Primitivismus behandelt und sich abschließend mit den Kultur- und Rassentheorien der Weimarer Republik beschäftigt. Zentrale Verdienste des Buches liegen darin, dass eine Forschungsnische gefüllt und weiterführende Forschungsfragen zum Thema ‚rassisch‘ transgressiver Sexualität aufgeworfen werden.

Geschlechterungleichheiten im Betrieb
Arbeit, Entlohnung und Gleichstellung in der Privatwirtschaft
Projektgruppe GiB, Erschienen in der Reihe Forschung aus der Hans-Böckler-Stiftung, Band 110, edition sigma, 2010, S. 564, 29,90€, ISBN 978-3-8360-8710-0
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In diesem Buch wird systematisch untersucht, wie sich in privatwirtschaftlichen Betrieben in Deutschland die Situation von Frauen und Männern darstellt. Berufliche Segregation, geschlechtsspezifische Einkommensdifferenzen, Arbeitszeitdauer, Qualität der Arbeit, Repräsentanz in Führungspositionen sowie atypische und prekäre Beschäftigung - zu diesen Themenfeldern arbeiten die Autoren und Autorinnen den Forschungsstand umfassend auf und erweitern den Blick durch neue empirische Analysen. Dadurch entsteht ein facettenreiches Bild der Geschlechterverhältnisse auf der betrieblichen Ebene. Überdies wird die betriebliche Gleichstellungspolitik in die Vielfalt internationaler Politikansätze eingeordnet, und Aktivitäten zur betrieblichen Gleichstellungsförderung werden diskutiert.
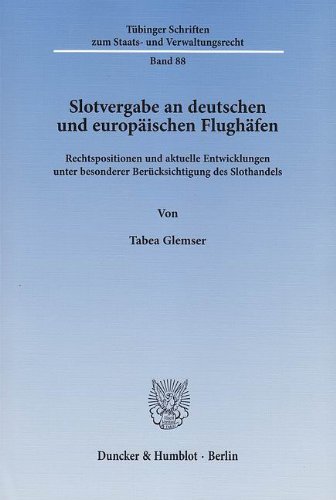
Slotvergabe an deutschen und europäischen Flughäfen
Rechtspositionen und aktuelle Entwicklungen unter besonderer Berücksichtigung des Slothandels
Tabea Glemser, Duncker & Humblot Verlag, 2010, S. 295, 68€, ISBN 978-3-4281-3388-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Vergabe wirtschaftlich interessanter Slots zu den Hauptverkehrszeiten bestimmt neben Faktoren wie Sicherheit und Service den Wettbewerb im Luftverkehr. Ziel der Arbeit ist eine Darstellung, Analyse und Beurteilung des gegenwärtig praktizierten Systems der Slotvergabe sowie eine rechtliche Beurteilung der in der Diskussion stehenden Möglichkeiten zur effizienteren Nutzung der Slots. Die Frage nach der Rechtsnatur eines Slots und nach möglichen Ansprüchen der Fluggesellschaften, der Flughafenbetreiber und der öffentlichen Hand bilden neben weiteren Fragen, die sich aus dem angestrebten Handel mit Slots ergeben, den Kern der Untersuchung. Die Autorin widmet sich insbesondere dem Eigentumsrecht und dem Recht auf chancengleiche und diskriminierungsfreie Teilhabe, insbesondere auch in Bezug auf die den Fluggesellschaften eingeräumten Großvaterrechte und einen sachgerechten Ausgleich zwischen alteingesessenen Anbietern und Neubewerbern.
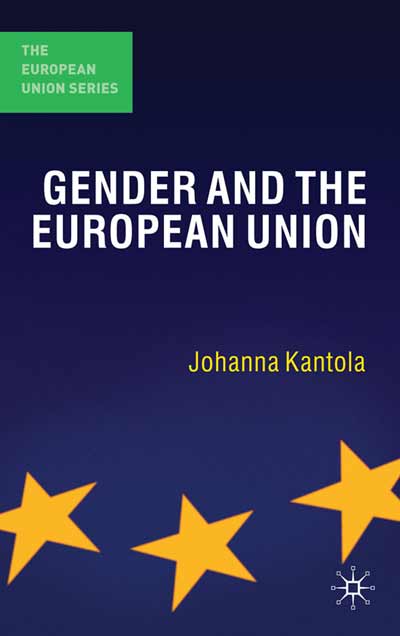
Gender and the European Union
Johanna Kantola, Palgrave, 2010, S. 270, ab 33,36€, ISBN 978-0-2305-4233-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Das vorliegende Buch stellt eine weitreichende und systematische Bewertung zur Entstehung des Genderbegriffs als wichtiges Thema innerhalb der EU dar. Zudem beleuchtet es den Einfluss des Begriffs auf ungleiche Geschlechterverhältnisse innerhalb der Grenzen der Vereinigung. Dabei bezieht es sich auf spezifisch geschlechtsbezogene Politik wie auch andere Politikbereiche, die die Genderthematik streifen.
Die Autorin ist Professorin im Bereich Gender Studies an der Fakultät für Philosophie, Geschichte, Kultur und Kunstgeschichte der Universität Helsinki. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Vergleich europäischer Modelle von Gleichstellungspolitik und Frauenbewegungen, feministischer Staatstheorie und Intersektionalität.
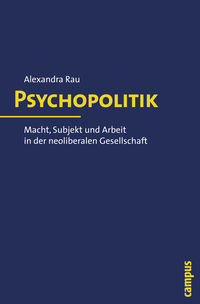
Psychopolitik
Macht, Subjekt und Arbeit in der neoliberalen Gesellschaft
Alexandra Rau, Campus Verlag, 2010, S. 450, 36,90€, ISBN 978-3-5933-9304-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Subjektivität von Arbeitskräften ist in den letzten Jahren von Unternehmen als Produktivfaktor entdeckt worden. Beschäftigte sollen und können sich mit ihrer ganzen Person und Erfahrung in den Arbeitsprozess einbringen. Im Anschluss an Michel Foucaults Konzept der Gouvernementalität untersucht Alexandra Rau die damit verbundenen neuen Formen der Macht, die weniger durch Zwang und Kontrolle als durch Anreize und Freiräume operieren. Zur Charakterisierung dieses neuen Machttypus entwickelt sie unter Berücksichtigung der Geschlechterverhältnisse den Begriff der Psychopolitik: Erst durch die Entstehung der modernen Psyche und damit korrespondierender Kämpfe konnte sich eine neue Regierungsweise herausbilden, die die neoliberale Gesellschaft insgesamt kennzeichnet.
Ausgezeichnet mit dem WISAG-Preis für die beste Dissertation an der Goethe-Universität Frankfurt am Main zum Thema "Gesellschaftlicher Zusammenhalt"

Europarechtliche Grenzen für die nationale Gesetzgebung im Bereich des Electronic Commerce
Eine Untersuchung anhand der deutschen Umsetzung der Fernabsatz-Richtlinien sowie der E-Commerce-Richtlinie
Isabell Schultze, Nomos Verlag, 2010, S. 565, 98€, ISBN 978-3-8329-5452-9
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Der Regelungsgehalt einer Richtlinie zur Angleichung der mitgliedstaatlichen Rechtsnormen kann durch die nationalen Gesetzgeber teils strenger umgesetzt werden. Praktisch relevant ist die Feststellung der europarechtlichen Grenzen des nationalen Legislativspielraums bei der Normierung solcher Schutzverstärkungen. Diese Schranken und Befugnisse bei der Umsetzung werden am Regelungsgegenstand des E-Commerce konkret herausgearbeitet. Neben der Reichweite strengerer nationaler Schutzstandards zur Fernabsatz-RL, Fernabsatz-RL für Finanzdienstleistungen und E-Commerce-RL wird der aktuelle Richtlinienvorschlag über Rechte der Verbraucher untersucht. Die Autorin berücksichtigt auch schon den Reformvertrag von Lissabon.Das Buch zeigt auf, inwieweit bestehende deutsche Schutzverstärkungen dem Europarecht widersprechen oder jedenfalls europarechtskonform interpretiert werden müssen. So ist 355 Abs. 2 S. 2 BGB als Umsetzungsnorm zur Fernabsatz-RL für Finanzdienstleistungen in seiner gegenwärtigen Form nicht zulässig. Zum gleichen Ergebnis kommt die Autorin im Hinblick auf den Richtlinienvorschlag über Rechte der Verbraucher. Die Verfasserin ist Mitautorin am Nomos-Verbraucherrechts-Kommentar der Herausgeber Tonner/Tamm.

Andere Räume
Soziale Praktiken der Raumproduktion von Drag Kings und Transgender
Nina Schuster, transcript Verlag, 2010, S. 328, 29,80€, ISBN 978-3-8376-1545-6
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Raum und Gesellschaft bedingen einander. Doch was prägt den Raum, wie wird er hergestellt? In dieser ethnographischen Studie wird Raumproduktion erstmalig aus der Perspektive sozialer Praktiken erforscht und mit heteronormativer Zweigeschlechtlichkeit in Verbindung gebracht. Am Beispiel der Heterotopie der Drag-King- und Transgender-Szene werden körper- und interaktionsbezogene Aspekte von Raumproduktion und Geschlechtskonstruktion, die Materialität und der sozialhistorische Kontext von Orten und Räumen sowie die Rolle sozialer Normen für die Raumproduktion beleuchtet. Nina Schuster zeigt, dass Raumproduktion immer ein unabgeschlossener, in Aushandlung befindlicher, facettenreicher sozialer Prozess ist.
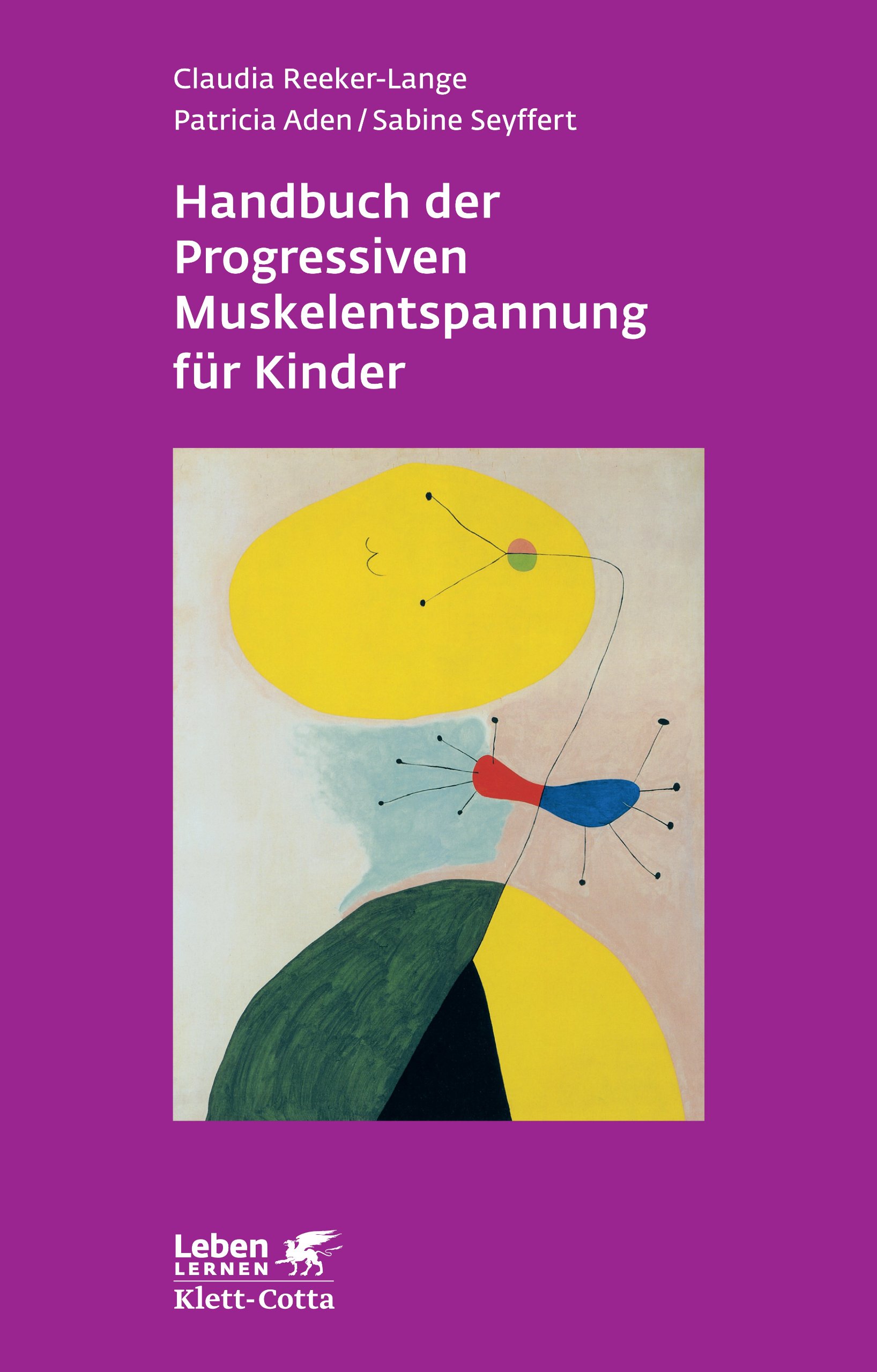
Handbuch der Progressiven Muskelentspannung für Kinder
Claudia Reeker-Lange, Dr. Patricia Aden, Sabine Seyffert, Klett-Cotta, 2010, S. 183, 22,95€, ISBN 978-3-6088-9100-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Progressive Muskelentspannung nach Jacobson ist ein von Ärzten und Therapeuten sehr häufig empfohlenes Entspannungsverfahren bei allen stressbedingten seelischen Erkrankungen. Dieses Buch schneidert den Ansatz auf die besonderen Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen zu. Im Zentrum stehen kindgerechte praktische Übungen, welche die grundlegenden Elemente des Verfahrens in spielerische Sequenzen und Fantasiereisen übertragen. Die Erfahrung zeigt, dass Kinder mit pyschosomatischen Beschwerden, AD(H)S, Spannungskopfschmerz, aggressivem Verhalten und anderen Verhaltensauffälligkeiten deutlich profitieren. Die einleitenden Kapitel erklären, wie die Progressive Muskelentspannung wirkt und warum Stress und Ängste durch sie beeinflussbar sind. Zielgruppen: - Kinder- und JugendlichenpsychotherapeutInnen - VerhaltenstherapeutInnen - alle, die pädagogisch, sozialpädagogisch und heilpädagogisch mit Kindern arbeiten.

60 Jahre Deutscher Akademikerinnenbund Kiel
Ein Beitrag zur Geschichte der Frauenbewegung
Vera Gemmecke-Kaltefleiter (Hrsg.), Edition Winterwork, 2010, S. 150, 8,90€, ISBN 978-3-9421-5092-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Im Oktober 2010 feierte die Ortsgruppe des DAB Kiel ihr 60-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat die Politologin Dr. rer. pol. Vera Gemmecke-Kaltefleiter die Vergangenheit der Gruppe erforscht, um mit deren Niederschrift einen Beitrag zur Geschichte der Frauenvereine in Kiel zu leisten.
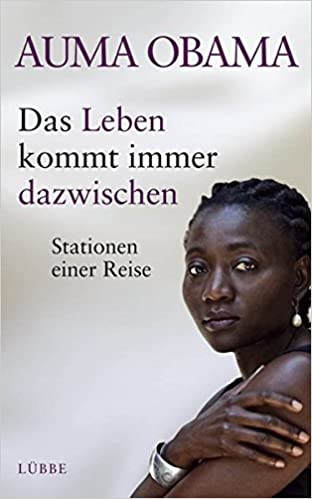
Das Leben kommt immer dazwischen: Stationen einer Reise
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Auma Obama wächst in Kenia auf, studiert in Heidelberg und Bayreuth, lebt 16 Jahre in Deutschland, später in England. Der Aufstieg ihres Bruders Barack führt sie mehrfach in die USA und zu gemeinsamen Reisen durch Kenia. Das Leben in gegensätzlichen Kulturen löst Gefühle der Entfremdung und Einsamkeit in ihr aus und lässt ein Bewusstsein für afrikanische Identität erwachen. Bald steht für sie fest: Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in ihrer Heimat ist der Schlüssel für eine bessere Zukunft.
Ein bewegend erzählter Bericht über Herkunft, Familie und den Mut, seine Ziele zu verfolgen.
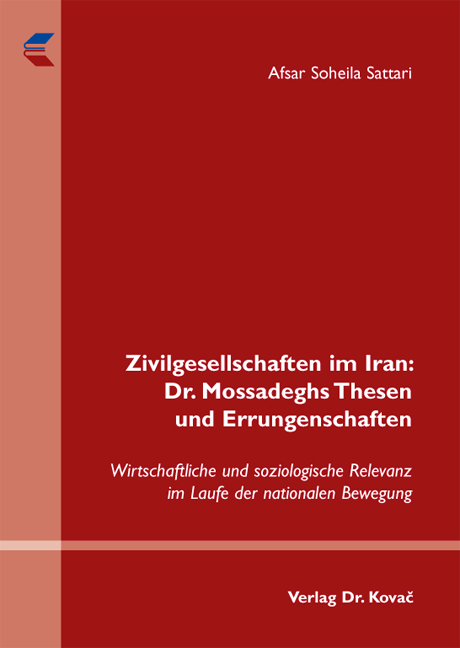
Zivilgesellschaften im Iran: Dr. Mossadeghs Thesen und Errungenschaften
Wirtschaftliche und soziologische Relevanz im Laufe der nationalen Bewegung
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Der unumstrittene Basisfaktor für die politische Stabilität, wirtschaftliche Prosperität und friedliche Entwicklung eines Landes ist das Vorhandensein der funktionierenden, rechtsstaatlichen Institutionen, die um eine starke Zivilgesellschaft aufgebaut sind.
Dr. Mossadegh, der herausragende Vertreter des Liberalismus iranischer Prägung, ist als Architekt der iranischen Zivilgesellschaft und eine Persönlichkeit, die die Verstaatlichung der Erdölindustrie des Irans unter Anwendung von friedlichen Mitteln auf internationalem Parkett herbeiführte, in die iranische Geschichte eingegangen. Seine Regierungszeit bezeichnet man als die zweite Phase der Konstitutionellen Revolution des Irans. Sein Demokratieverständnis schloss in sich innenpolitisch die Etablierung von konstitutionellen Grundsätzen in einem System des demokratischen Parlamentarismus, die Einschränkung der Macht des Schahs, freie demokratische Wahlen und die Errichtung einer funktionierenden und vitalen Zivilgesellschaft sowie außenpolitisch die Unabhängigkeit von Kolonialmächten und die Verfolgung der Politik des Negativen Gleichgewichts mit ein.
Durch die Operation TP-Ajax verloren der Iran und die Region eine historische Chance zur Errichtung und Konsolidierung der Demokratie und folgedessen entstand ein Nährboden für politischen und weltanschaulichen Extremismus.
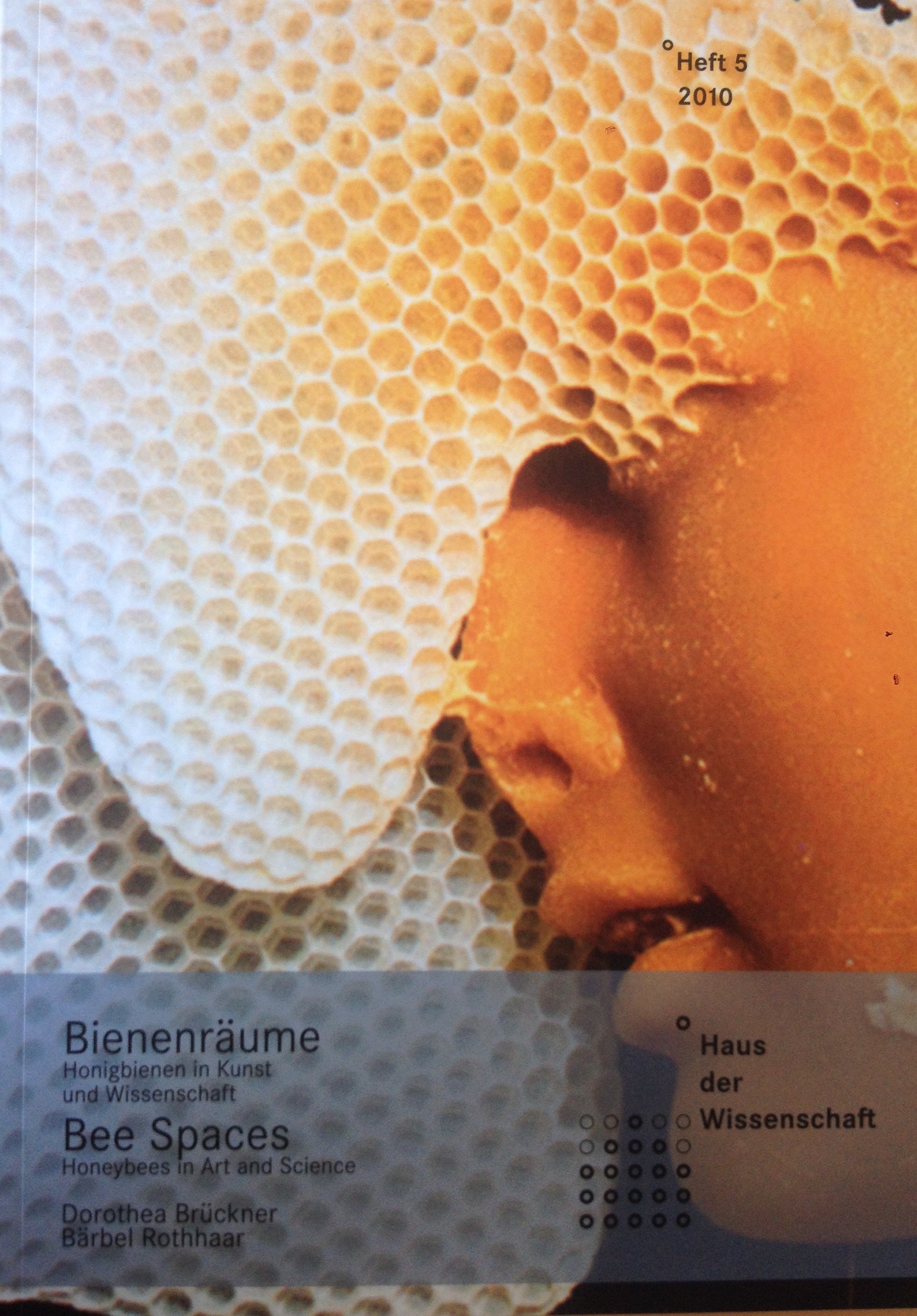
Bienenräume
Honigbienen in Kunst und Wissenschaft
Dorothea Brückner, Bärbel Rothhaar, Haus der Wissenschaft, 2010, S. 96, 10€
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Seit 2004 führen die Bienenbiologin Dorothea Brückner und die Konzeptkünstlerin Bärbel Rothhaar einen innovativen Dialog, wobei sie ihre völlig unabhängigen Blickwinkel zum Thema Honigbiene aktiv einbringen. Im Buch "Bienenräume" werden die fünf Themen: Wachs, Schlaf, Duft, Raumkognition und Pollen aus künstlerischer und wissenschaftlicher Perspektive betrachtet. Eine der wichtigsten Fragen des Buches ist der Vergleich des künstlerischen Ansatzes mit dem naturwissenschaftlichen zum Thema Honigbiene. Wo und wie setzen Künstler und Wissenschaftler ähnliche Methoden ein und wo erzielen sie ähnliche ästhetische Ergebnisse? Wodurch unterscheiden sich ihre Ziele und Methoden möglicherweise grundlegend?
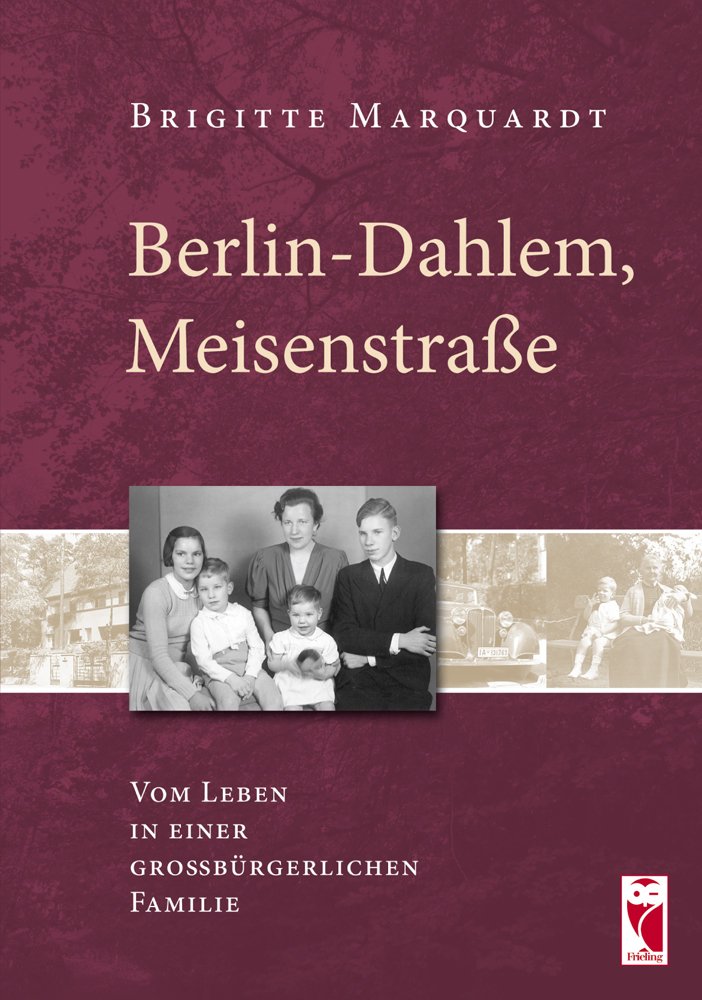
Berlin-Dahlem, Meisenstraße
Vom Leben in einer grossbürgerlichen Familie
Brigitte Marquardt, Frieling Verlag, 2010, S. 304, 19,90€, ISBN 978-3-8280-2814-2
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Autorin wuchs in Berlin im vornehmen Bezirk Dahlem auf. Ihre farbenfrohe und spannend geschriebene Familiengeschichte verknüpft Persönliches und Zeitgeschichtliches mit dem Schicksal ihrer Eltern und Großeltern. Die glückliche Kindheit im wohlhabenden Elternhaus wird durch die Zwänge der Nazizeit abrupt beendet. Dies gipfelt in einem Hochverratsverfahren gegen die Studentin wegen ihrer Äußerungen zum Attentat auf Hitler im Juli 1944. 1945 erlebt sie aus nächster Nähe die Schlacht um Berlin sowie die Beschlagnahme des elterlichen Hauses zunächst durch die russische, dann durch die amerikanische Militärverwaltung. Das jahrelange Zusammenleben der Familie mit amerikanischen Besatzungsoffizieren wird eingehend geschildert. Das Leben der Autorin verändert sich durch die Gründung einer eigenen Familie. Ihr Mann arbeitet sich nach dem Studium von einer schlecht bezahlten Anfangsposition hoch zur Nummer eins eines bedeutenden deutschen Unternehmens. Sie wächst mit. Brigitte Marquardts Memoiren erzählen die Entwicklungsgeschichte einer starken jungen Berlinerin und sind zugleich ein bewegendes Zeitdokument.
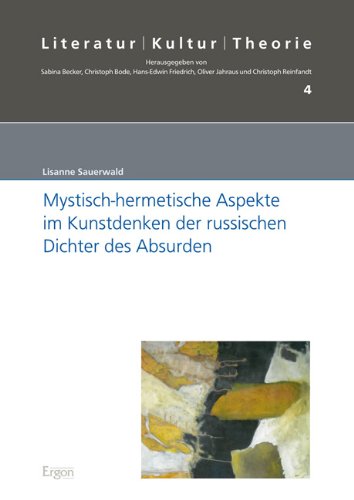
Mystisch-hermetische Aspekte im Kunstdenken der russischen Dichter des Absurden
Lisanne Sauerwald, als Band 4 in der Reihe Literatur, Kultur, Theorie erschienen, Ergon Verlag, 2010, S. 439, 52€, ISBN 978-3-8991-3812-2
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Dieses Buch bietet eine literatur- und kulturwissenschaftliche Analyse der Autoren russischer absurder Literatur, die der spätavantgardistischen Künstlergruppe OBERIU (Ob''edinenie Realnogo Iskusstva - Vereinigung der Realen Kunst) angehörten: Igor' Bachterev, Konstantin Vaginov, Nikolaj Zabolockij, Daniil Charms und Aleksandr Vvedenskij. Im Mittelpunkt stehen dabei die mystisch-hermetischen Aspekte im Denken und Schreiben der OBERIU-Autoren, insbesondere von Daniil Charms und Aleksandr Vvedenskij. Unter Berücksichtigung ihrer Verbindung zum geheimbündlerischen Freundeskreis der "Cinari", dem auch der Kinderbuchautor Nikolaj Olejnikov sowie die zwei Philosophen Jakov Druskin und Leonid Lipavskij angehörten, stellt dieses Buch eine Zusammenschau und Gesamtdarstellung der literarisch-philosophischen Aspekte russischer absurder Literatur dar. Die Untersuchung mystisch-hermetischer Motive und stilistischer Merkmale offenbart dabei wesentliche Unterschiede, aber auch Parallelen zu Autoren westlicher absurder Literatur, die oftmals als nihilistisch-atheistisch gekennzeichnet wurden. Müssten die Becketts und Ionescos angesichts ihrer russischen Vorgänger rückwirkend nicht neu gelesen werden? Zu diesen und weiteren Überlegungen regt diese sorgfältig recherchierte Studie eines Stücks zwischenzeitlich vergessener russischer Literaturgeschichte an.
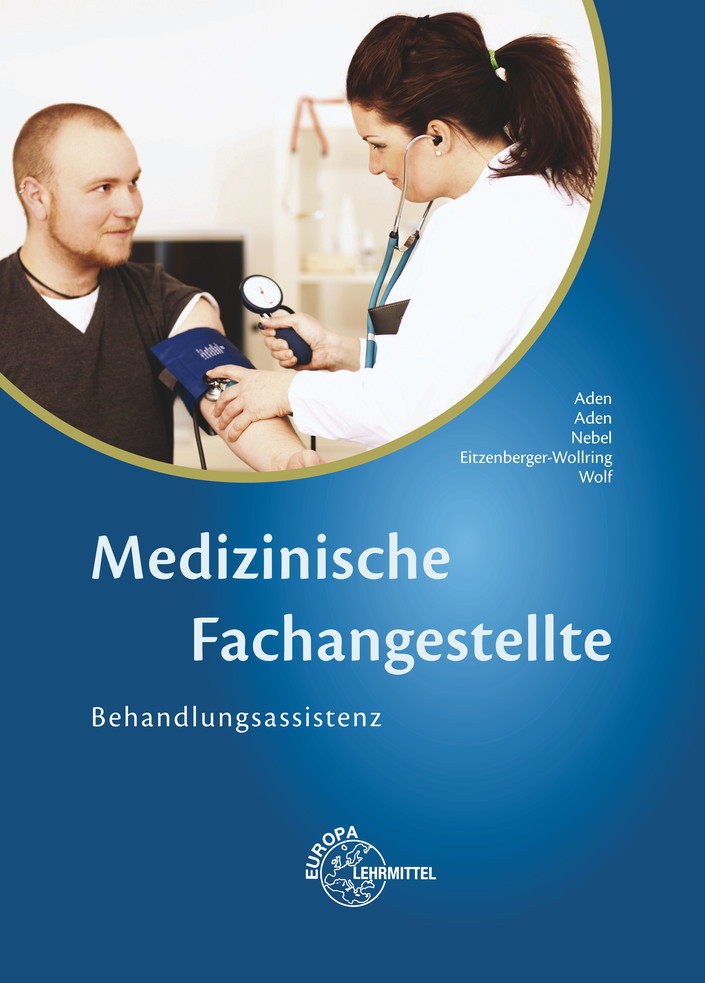
Medizinische Fachangestellte
Behandlungsassistenz
Dr. med. Patricia Aden, Dr. med. Konrad Aden, Dr. Helga Eitzenberger-Wollring, Dr. Susanne Nebel, Edeltraud Wolf, Europa Lehrmittel, 2009, S. 444 mit CD, 6,95€, ISBN 978-3-8085-6966-5
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die 6. Auflage ist durchgängig nach Lernfeldern geordnet. Jedes Lernfeld wird mit einem handlungsorientierten Praxisfall eingeleitet.
Neu aufgenommen wurde ein eigener Laborteil, der den Anforderungen des Unterrichts entspricht. Die für das umfassende Verständnis des menschlichen Körpers wichtigen Inhalte Auge, Ohr und Nervensystem wurden zusätzlich zu den im Rahmenlehrplan geforderten Themen mit aufgenommen. Die auf der CD enthaltenen Bilder und Tabellen können extrahiert und in andere Dokumente eingefügt werden. Die Inhalte entsprechen dem Rahmenlehrplan und den Anforderungen der Zwischen- und Abschlussprüfung.
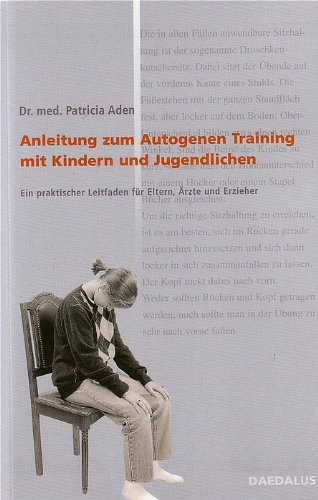
Anleitung zum Autogenen Training mit Kindern und Jugendlichen
Ein praktischer Leitfaden für Eltern, Ärzte und Erzieher
Dr. Patricia Aden, Daedalus Verlag, 2009, S. 214, 16,80€, ISBN 978-3-8912-6171-2
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die praktische Umsetzung des autogenen Trainings bei der Behandlung psychosomatischer Krankheiten und stressbedingter Verhaltensstörungen steht im Mittelpunkt dieses Leitfadens. Die Autorin stellt die Methode zugleich in einen erweiterten pädagogischen Rahmen und veranschaulicht die Bedeutung des autogenen Trainings für den gesamten Erziehungsprozess.

Erziehungswissenschaftlerinnen in der Frauen- und Geschlechterforschung
Prof. Dr. Anne Schlüter, 2008, Opladen: Barbara Budrich, S. 204; ISBN 978-3-86649-155-7; 22,90 EUR
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Das Buch gestattet einen speziellen Blick auf die Anfänge der Frauen- und Ge-schlechterforschung bis hinein in die 1990er Jahre. Es ist für alle, die dieses For-schungsgebiet weiterführen wollen oder sich dafür aus anderen Gründen interessie¬ren, ein wertvolles Dokument. Aber der Sammelband eignet sich nicht nur als histori¬sches Dokument - „So war das damals also!“, sondern auch als Antwort auf Bärbel Schöns Frage: „Was lernt uns das?“ (136) Es lernt uns aus Sicht der unmittelbar Beteiligten, dass Frauennetzwerke viel erreicht haben und dass solche Zusammenschlüsse weiterhin unerlässlich sind, um auf dem Weg zur Chancengleichheit in der Wissenschaft weiter voran zu kommen. Und es lernt uns, Mut zu haben. Mut zu eigenen Wegen, neuen Fragen und Projekten und vor allem zu einer individuellen, freien Lebensführung im Kontext wissenschaftlichen Arbeitens.
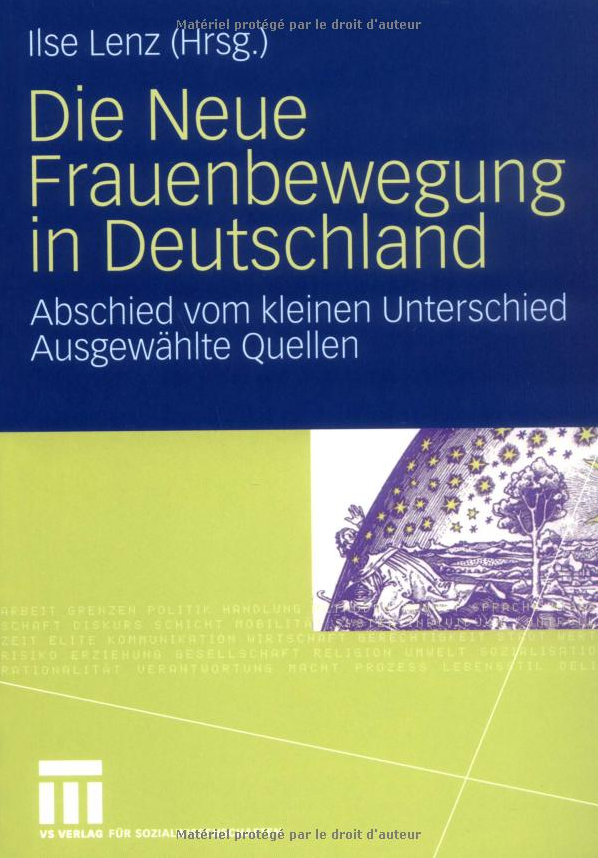
Die Neue Frauenbewegung in Deutschland
Abschied vom kleinen Unterschied. Eine Quellensammlung
Ilse Lenz (Hrsg.), VS-Verlag für Sozialwissenschaften, 2008, S. 1195, gebunden 49,90€, Taschenbuch 29,90€, ISBN 978-3-5311-4729-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Neuen Frauenbewegungen haben Selbstbestimmung, Gleichheit, Zuwendung und einen neuen Eros gefordert und sie haben die Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland grundlegend verändert. Dabei haben sie sich auch selbst transformiert. Der Band dokumentiert ihre wichtigsten Quellen und stellt sie in ihrer Vielfalt und ihren Veränderungen vor. Auch die Reaktionen der Männerbewegung wurden aufgenommen. Der Band eröffnet einen einzigartigen Zugang zu den Kontroversen um Geschlecht und gesellschaftlichen Wandel in Deutschland seit 1968. Diese Texte sind weiterhin aktuell angesichts der Debatten um die Zukunft der Arbeit, der Familie und des Friedens vor Ort und auf globaler Ebene.

Femmes et Résistance en Belgique et en zone interdite
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
En consacrant leur troisième rencontre scientifique, en janvier 2006, aux Femmes et à la Résistance pendant la Seconde guerre mondiale, le Musée de Bondues et ses partenaires universitaires de l'IRHiS de Lille et du CEGES de Bruxelles, poursuivent leur recherche comparée sur la Résistance en Belgique et dans la « zone rattachée ».
Comprendre la diversité des engagements et des itinéraires, mesurer la part des femmes dans l'action résistante, évaluer la « résistance au féminin » dans une conjoncture où les risques sont très élevés, tant de la part de l'occupant allemand que du gouvernement de Vichy, sont autant de pistes ouvertes qui permettent de réfléchir à l'évolution du statut et du rôle des femmes dans la vie sociale et politique du premier vingtième siècle.
La publication des Actes offre aussi la possibilité de faire connaître, dans une forme « d'histoire au quotidien » des témoignages précieux sur la vie de résistante.
Aus: books.openedition.org/irhis/2170
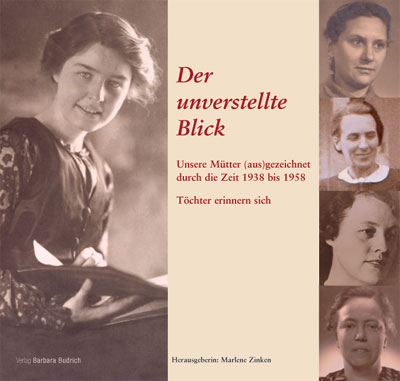
Der unverstellte Blick
Unsere Mütter (aus)gezeichnet durch die Zeit 1938 bis 1958
Marlene Zinken (Hrsg.), Erschienen in der Reihe Schriften aus dem Haus der FrauenGeschichte, Budrich-Verlag, 2007, S. 229, 19,90€, ISBN 978-3-8664-9190-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Geschichte in Biografien - Biografien der Mütter erzählt von den Töchtern: Die vielschichtigen Erinnerungsberichte beweisen in aller Deutlichkeit, dass sich Geschichte aus der Sicht von Frauen auf eine neue Weise darstellt. Andere Prioritäten bestimmen die Betrachtungsweise. Unbeachtete Schwerpunkte bekommen Gewicht. Hoffnungen und Erwartungen für die Zukunft lassen sich davon ableiten.
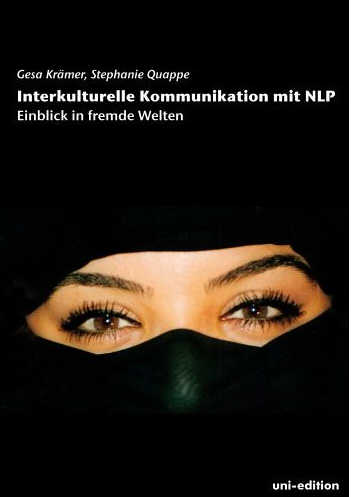
Interkulturelle Kommunikation mit NLP
Einblick in fremde Welten
Gesa Krämer, Stephanie Quappe, Uni-Edition, 2006, S. 267, 29,90€, ISBN 978-3-9371-5143-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Kontakte mit anderen Kulturen sind Teil unseres Alltags, doch oftmals stoßen wir beim Umgang mit Menschen anderer Kulturkreise auf kommunikative Hürden. „Interkulturelles Training mit NLP“ von Gesa Krämer und Stephanie Quappe bietet Ihnen konkrete Konzepte, mithilfe derer Sie sich im Dschungel fremder Sitten und Gebräuche besser zurechtfinden und kulturell bedingten Verständigungsproblemen entgegenwirken können. Die beiden Autorinnen entwickeln Formate und Beispiele entlang der logischen Ebenen von R. Dilts, um eine integrative und ganzheitliche Arbeit mit dem Fremden zu ermöglichen. Zahlreiche Übungen dienen dazu, einen Auslandsaufenthalt vorzubereiten, Unsicherheiten zu verringern und fremde Kultur sowohl vor Ort als auch im eigenen Land positiv erleben zu können.
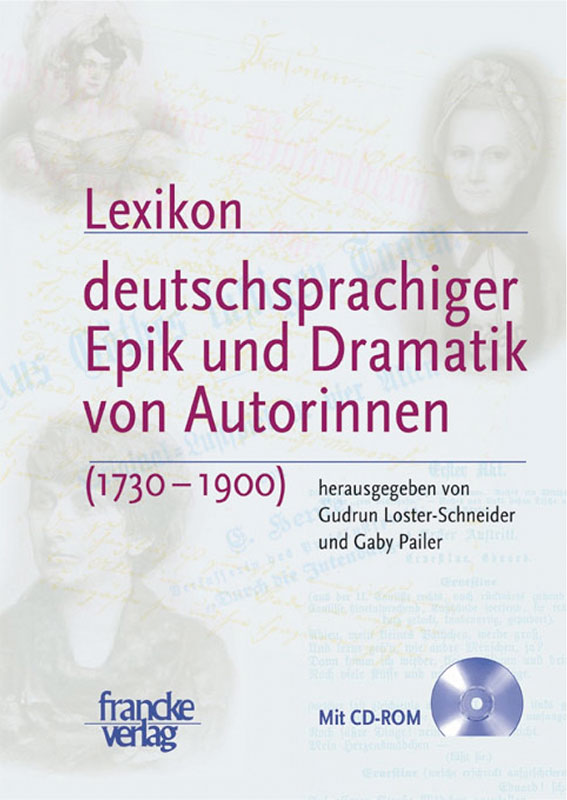
Lexikon deutschsprachiger Epik und Dramatik von Autorinnen
(1730-1900)
Prof. Dr. Gudrun Loster-Schneider, Prof. Dr. Gaby Pailer, Francke Verlag, 2006, S. 491 mit CD-ROM, 79€, ISBN 978-3-7720-8189-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
340 Dramen und Prosawerke von rund 200 deutschsprachigen Schriftstellerinnen des 18. und 19. Jahrhunderts werden hier (zum Teil erstmals wieder) zugänglich gemacht. Vertreten sind größtenteils "vergessene" Autorinnen von Ahlefeld bis Zitz, aber auch Kanonautorinnen, wie Gottsched, La Roche, Arnim oder Andreas-Salomé. Im Vordergrund stehen dabei nicht biographische Daten, sondern die Werke der Autorinnen. Diese decken inhaltlich ein breites Spektrum ab: Historische Romane stehen neben Revolutionsdramen, (auto-)biographischen Erzählungen, Reiseschilderungen, satirischen Lustspielen und Märtyrernovellen. Durch seine Fülle an behandelten Werken unterscheidet sich dieser Band von allen bisherigen Autorinnen-Lexika. Er liefert zuverlässige Informationen für Literaturwissenschaftlerinnen und Kulturwissenschaftler und ist darüber hinaus ein Lesegenuss für ein an Literatur interessiertes allgemeines Lesepublikum.
Die beiliegende CD-ROM ist als modernes Sachregister nutzbar und ermöglicht eine gezielte und komfortable Recherche nach Autorinnen, Werktiteln und weiteren wichtigen Daten sowie eine Volltextsuche im Artikeltext. Zusatzfunktionen, wie eigene Notizen zu Lexikonartikeln erstellen und verwalten, Text markieren, ausdrucken oder Lesezeichen setzen, machen die CD-ROM zu einem wertvollen Arbeitsinstrument. Die bibliographische Referenz auf das gedruckte Werk ist bei jedem Artikel elektronisch hinterlegt. Besprechung von Gabriele Jöck (20.05.2007):
"Gudrun Loster-Schneider stellte der DAB-Regionalgruppe im Rhein-Neckar-Dreieck ihr neuestes Werk vor, das sie zusammen mit einer Kollegin verfasste. Anders als in den vielen anderen Nachschlagewerken, in denen das Leben und Schaffen von Schriftstellerinnen dargestellt wird, befasst sich dieses Kompendium ausführlich mit den Werken und nur marginal mit der Biografie der ausgewählten Schriftstellerinnen aus eineinhalb Jahrhunderten. Es lässt sich darin sowohl genüsslich schmökern als auch mithilfe der beigefügten CD gründlich recherchieren. Inzwischen wird der Band auch schon das "Frauen-Kindler" genannt als weibliche Alternative zu "Kindlers Literatur Lexikon", das überwiegend schreibende Männer benennt."
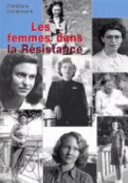
Les femmes dans la Résistance
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In der französischen Résistance engagierten sich Frauen, die verschiedenen Glaubensrichtungen angehörten, unterschiedliche politische Überzeugungen vertraten und aus allen Schichten der Gesellschaft kamen. Die ehemaligen Kombattantinnen nennen patriotische, ideologische und persönliche Motive für den Eintritt in den Widerstand.
In der Wahrnehmung ihrer Aktivitäten zeichneten sich die Frauen in der Résistance durch große Flexibilität, Organisationsfähigkeit, Hilfsbereitschaft und durch großen Mut aus. Phasenweise waren sie parallel oder nacheinander in verschiedenen Mouvements oder Réseaux tätig, arbeiteten als Verbindungsagentinnen in ganz Frankreich und scheuten nicht davor zurück, auch ihre Kinder den größten Gefahren auszusetzen. Es gelang den Kombattantinnen, ein Mikromodell neuen gesellschaftlichen Zusammenlebens zu schaffen, in dem ideologische, politische oder religiöse Unterschiede an der Basis weitgehend irrelevant waren.
Nach Ende der Libération scheiterten einige Frauen in der Parteipolitik, engagierten sich vorrangig in humanitären Organisationen und machten zum Teil eine herausragende Karriere. Persönlichkeit und Aktivitäten bildeten in der Résistance, im Konzentrationslager und in der Lebensphase nach dem Zweiten Weltkrieg bei vielen Frauen eine Einheit.
Mit Hilfe eines neuen methodischen Zugangs gelingt es Christiane Goldenstedt, in ihrem Buch neue Primärquellen zu erschließen, nach einer gründlichen Quellenlektüre einen Vergleich mit einschlägiger Sekundärliteratur herzustellen und neue Diskurse in der Forschung zu eröffnen.
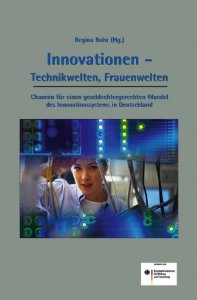
Innovationen - Technikwelten, Frauenwelten
Chancen für einen geschlechtergerechten Wandel des Innovationssystems in Deutschland
Regina Buh (Hrsg.), Wostok Verlag, 2006, S. 176, 16,00€, ISBN 978-3-9329-1632-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Entwicklung in ingenieurwissenschaftlichen Studien- und technischen Ausbildungsgängen zeigt, dass Technik für immer mehr junge Frauen attraktiv wird. Noch nie gab es so viele Studienanfängerinnen in den Ingenieurwissenschaften wie im Jahre 2004. Doch immer mehr Technikfrauen verlassen oder verlieren nach einiger Zeit ihren technischen Arbeitsplatz. Aus wirtschaftlichen und emanzipatorischen Gründen ist jedoch die nachhaltige Integration von Frauen in technischen Arbeitswelten unerlässlich. Nur mit den Kompetenzen, dem Wissen und den Fertigkeiten qualifizierter Technikerinnen und Ingenieurinnen ist die technische Vorrangstellung Deutschlands zu erhalten.
Die Autorinnen des Buches (Wissenschaftlerinnen, Gewerkschafterinnen, Unternehmerinnen) ziehen folgenden Schluss: Wenn man mehr Mädchen und Frauen für technische Berufe gewinnen und ihre erfolgreichen Karriereverläufe in diesen Bereichen sichern will, dann müssen Änderungen in den Rahmenbedingungen von Schule, Ausbildung und Studium stärker als bisher mit strukturellen und kulturellen Veränderungen der Arbeitswelt verknüpft werden. Um sicherzustellen, dass junge Frauen in ihren anvisierten Berufsfeldern gehalten werden, bedarf es zudem gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und politischer Veränderungen, die schulische Techniksozialisation, technische Ausbildung und Berufstätigkeit als verzahnte Einheit betrachten.
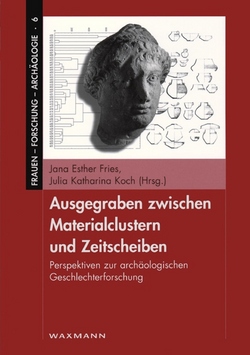
Ausgegraben zwischen Materialclustern und Zeitscheiben
Perspektiven zur archäologischen Geschlechterforschung
Jana Esther Fries, Julia Katharina Koch (Hrsg.), Waxmann Verlag, 2005, S. 169, 14,90€, Frauen – Forschung – Archäologie, Band 6, ISBN 3-8309-1515-2
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Prähistorische Archäologie nimmt sich seit einigen Jahren einer neuen Fragestellung an: Frauen- und Männerrollen gelten nicht mehr als universell und ahistorisch, sondern werden als veränderlich und als Teil der jeweiligen sozialen Ordnung begriffen. Damit öffnet sich ein umfangreiches Aufgabenfeld für prähistorische Frauen- und Geschlechterforschung. Dieser Tagungsband bietet einen vielfältigen Überblick über die aktuell diskutierten Fragestellungen, Methoden und Ergebnisse von den Niederlanden über den Kaukasus bis Australien.
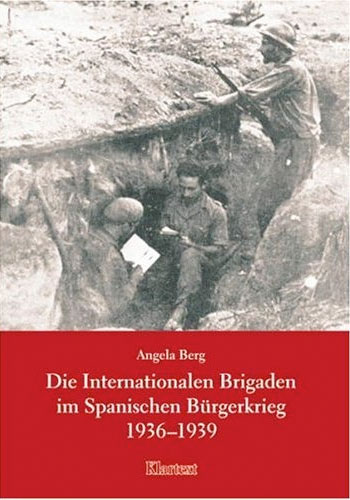
Die Internationalen Brigaden im Spanischen Bürgerkrieg 1936 - 1939
Angela Berg, Klartext-Verlag, 2005, S. 306, 29,90€, ISBN 978-3-8986-1418-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Leidenschaften, Emotionen und Irrationalität prägen bis heute den Blick auf den Spanischen Bürgerkrieg und die Internationalen Brigaden. Dazu zählt sowohl das Bild der Internationalen Brigaden als antifaschistische Helden, wie auch die Auffassung, dass es sich bei ihnen um moskauhörige Söldner gehandelt habe. Ziel des Buches ist, einen entscheidenden Beitrag zur Versachlichung und Entmythologisierung dieses kontrovers diskutieren Themas zu leisten. Dabei stehen die Mechanismen der Herausbildung dieser Truppe aus zusammen gewürfelten Freiwilligen, ihre internen Auseinandersetzungen sowie die vielfältigen Beziehungen zu ihrer Umgebung im Mittelpunkt. Zum anderen stellt die Untersuchung die Lebenswirklichkeit der einfachen Soldaten und die Handlungsmöglichkeit der Führung dar; so kommt das Buch einer inneren Wirklichkeit der internationalen Brigaden auf die Spur, die bislang unbeachtet blieb. Die Studie versteht sich darüber hinaus als Baustein für die Erforschung der Geschichte der kommunistischen Arbeiterbewegung. Ansprüche und Wirklichkeit der kommunistischen Ideologie und ihrer historischen Handlungsträger werden innerhalb der Internationalen Brigaden dechiffriert und analysiert. Konkreter als bisher und ohne Vorbehalte fragt Angela Berg nach den Zielen deutscher kommunistischer Entscheidungsträger in Spanien, wie sie diese zu realisieren versuchten und auf welche Grenze sie dabei stießen.
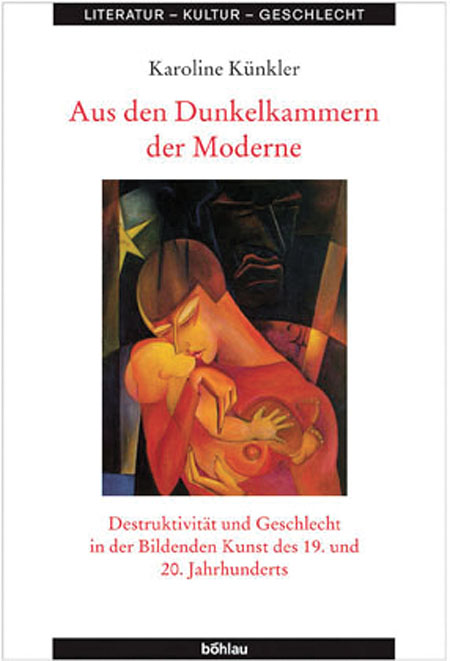
Aus den Dunkelkammern der Moderne
Destruktivität und Geschlecht in der Bildenden Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts
Karoline Künkler, Böhlau Verlag, 2005, S. 512, 64,90€, ISBN 978-3-4121-8005-8
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Ein zerrüttetes Paar - in zersetzender Bildsprache gezeichnet von Francisco de Goya; ein Lustmord - von George Grosz mit verletzender Feder in Papier geritzt; eine trauernde Mutter im stillen Duell mit ihrem Lebensgefährten - ausgetragen mit gemalten Schnitten von Hannah Höch: Anhand solcher und anderer Beispiele zeigt das Buch auf, welche Formen das Zerstörerische innerhalb der Bildenden Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts annehmen kann. Es geht um die Schattenseiten der westlichen Kultur, der auch die Künstler und ihre Werke angehören. Weil die Neubestimmung des Geschlechterverhältnisses in der Moderne nur unvollständig vollzogen wurde, eröffneten sich den künstlerischen Avantgarden immer wieder Spielräume für rückläufige Tendenzen, für Gewaltverehrung und Zerstörungsakte. Das Buch bietet kultur- und sozialhistorisch eingebettete Analysen von Bildwerken und Performances und vermittelt einen umfassenden Blick auf die kunstspezifischen Formen männlicher und weiblicher Destruktivität.
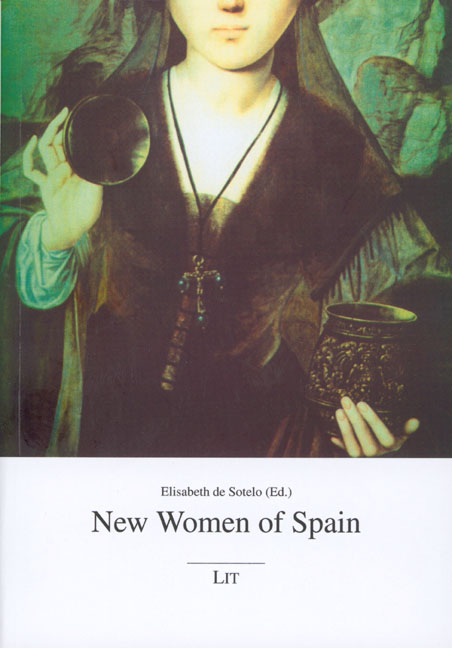
New Women of Spain
Social-Political and Philosophical Studies of Feminist Thought
Irmhild Kettschau, Elisabeth Sotelo (Hrsg.), Erschienen in der Reihe Frauenstudien und emanzipatorische Frauenarbeit, Band 4, LIT Verlag Münster, 2005, S. 457, 25,90 €, ISBN 978-3-8258-6199-5
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
New Women of Spain ist eine Sammlung von Essays. Das Buch ermöglicht einen tiefen Einblick in den Stand der feministischen Positionen der weiblichen spanischen Gelehrten. Der Fokus liegt dabei auf den sozialen und politischen Errungenschaften, die durch den Feminismus während des Übergangs Spaniens zur Demokratie erreicht wurden. Die Leserin kann sich hier einen guten Überblick über die radikalen Veränderungen des Frauenbildes verschaffen. Dazu gibt dieser Band einen klugen Überblick über die Bandbreite der akademischen Forschung zu feministischen und Gender-Themen und veranschaulicht die Entwicklung dieses Themas in den letzten 30 Jahren und dessen zunehmende Differenziertheit.
New Women of Spain ist ein hervorragendes Beispiel für die dramatische Weiter-Entwicklung des Feminismus in Spanien und seiner Auswirkung auf die Gesellschaft und auf den heutigen Status der Spanierinnen.
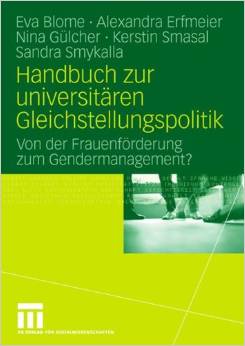
Handbuch zur universitären Gleichstellungspolitik
Von der Frauenförderung zum Gendermanagement?
Eva Blome, Alexandra Erfmeier, Nina Gülcher, Kerstin Smasal, Sandra Smykalla, VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005, S. 308, 49,99€, ISBN 978-3-8100-4216-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Universitäre Gleichstellungspolitik bewegt sich derzeit im Spannungsfeld von aktuellen geschlechtertheoretischen Debatten und den Reformbestrebungen an deutschen Hochschulen. Das Handbuch will der zunehmenden Komplexität universitärer Gleichstellungsarbeit Rechnung tragen und zu ihrer Professionalisierung beitragen. Der erste Teil vermittelt theoretische Grundlagen und regt zur Reflexion der Erkenntnisse aus der Geschlechterforschung an, die gleichstellungspolitische Praxis beeinflussen. Im zweiten Teil liegt der Schwerpunkt auf den konkreten Aufgabenfeldern und Handlungsmöglichkeiten von Gleichstellungsbeauftragten an der Hochschule. In der Verschränkung von Theorie und Praxis sollen Paradoxien gleichstellungspolitischen Handelns als Herausforderung produktiv gemacht werden.
Pressestimmen
"Universitäre Gleichstellungspolitik bewegt sich im Spannungsfeld von aktuellen geschlechtertheoretischen Debatten und den Reformbestrebungen an den Hochschulen. Dies erfordert von den Verantwortlichen: Sie müssen gut informiert sein über die Erkenntnisse aus der Geschlechterforschung und sie müssen sich Instrumente für wirkungsvolles gleichstellungspolitisches Handeln aneignen. Eine gute Informationsbasis bietet dafür das von ehemaligen Frauenbeauftragten verfasste Handbuch." duz - Unabhängige Deutsche Universitätszeitung, 12-2009
"Der besondere Verdienst der Autorinnen besteht in der Zusammenführung von Eindrücken aus der Gleichstellungspraxis und Ergebnissen einer langjährigen Auseinandersetzung mit feministischer Theoriebildung zu einer gleichstellungspolitischen Gesamtschau." Die Hochschule - Journal für Wissenschaft und Bildung, 1-2006
"Abschließend bleibt festzuhalten, dass den Autorinnen ein Handbuch gelungen ist, das der Komplexität universitärer Gleichstellungsarbeit Rechnung trägt, weil es einen aktuellen, informativen sowie inhaltlich breiten Überblick über die verschiedenen Aspekte und Praradoxien von universitärer Gleichstellungspolitik liefert." Feministische Studien, 1-2006
"Es wäre zu wünschen, dass jede Frauenbeauftragte mit ihrem Amt zugleich auch dieses Buch in die Hand bekommt." www.querelles-net.de, 24.04.2006
"Für die Arbeit an Hochschulen, egal, in welcher Tätigkeit, unverzichtbar; und [...] auch für andere Frauenbeauftragte, z.B. an Bildungseinrichtungen, eine gute Anregung und Weiterbildung." Wir Frauen, 4-2005

Karriere und Kind
Erfahrungsberichte von Wissenschaftlerinnen
Nikola Biller-Andorno, Anna-Karina Jakovljevic, Katharina Landfester, Min Ae Lee-Kirsch (Hrsg.), Campus-Verlag, 2005, S. 308, 24,90€, ISBN 978-3-5933-7713-1
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Karriere mit Kindern - was das für Frauen bedeutet, die sich im Wissenschaftsbetrieb behaupten, berichten hier Akademikerinnen aus verschiedenen Disziplinen und in unterschiedlichen Stadien ihres Werdegangs. Sie schildern, wie sie Beruf und Elternschaft verbinden, und lassen uns sowohl bittere als auch glückliche Momente in diesem Balanceakt miterleben. Die Beiträge skizzieren unterschiedliche Lebensmodelle, mit denen sich Frauen den besonderen Herausforderungen ihrer doppelten Beanspruchung stellen. Die Lektüre ist erhellend nicht nur für Frauen, die sich in einer ähnlichen Situation befinden, sondern auch für deren Partner und Familien und für alle, die mit Wissenschafts-, Bildungs- und Familienpolitik zu tun haben.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie auf dem MentorinnenNetzwerk für Frauen in Naturwissenschaft und Technik.
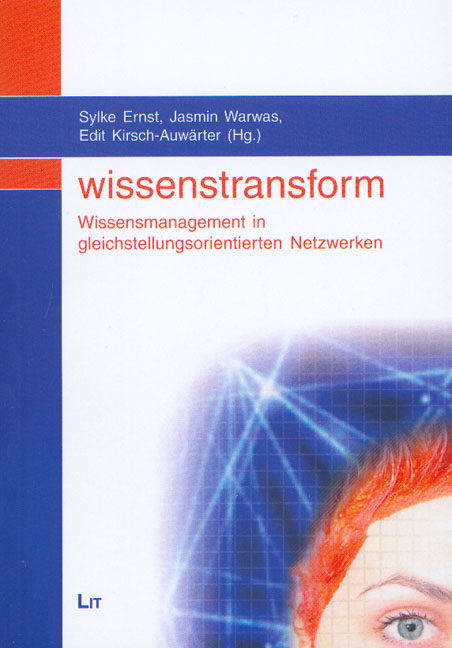
wissenstransform
Wissensmanagement in gleichstellungsorientierten Netzwerken
Sylke Ernst, Jasmin Warwas, Edit Kirsch-Auwärter (Hrsg.) , LIT Verlag, 2005, S. 197, 19,90€, ISBN 978-3-8258-8553-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Was hat Wissensmanagement mit Gleichstellungsarbeit zu tun? Dieser Frage gehen die Herausgeberinnen mit einer gelungenen Zusammenstellung von Beiträgen aus Wissenschaft und Praxis nach. Erstmals werden Aspekte des Wissensmanagements mit gleichstellungsorientierten Fragen und Herausforderungen kombiniert – die Leserin bekommt in Theoriebeiträgen, in Studienberichten und in Beschreibungen von Praxisbeispielen einen fundierten Überblick über die Themenbereiche Wissensmanagement, Lernen und Kommunikation in Netzwerken.
Das Besondere, Innovative an dieser Zusammenstellung ist der Gender-Blickwinkel auf diese Themen – diese neue Sicht auf Wissensmanagement ist ein innovativer Brückenschlag, der sowohl dem Wissensmanagement als auch der Gleichstellungsarbeit neue Facetten und Einsichten bringt. Die Lektüre der Beiträge lässt altbewährte Modelle und Ergebnisse der in die Jahre kommenden Wissensmanagement-Debatte zu neuer, gesellschaftspolitischer Relevanz und Aktualität erwachen.
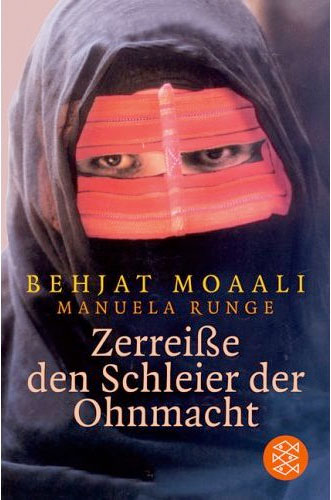
Zerreiße den Schleier der Ohnmacht
Behjat Moaali, Manuela Runge, Krüger Verlag, 2003, S. 250, 7,50€, ISBN 978-3-8105-1285-7
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
"Tara, stolze Schwester" erzählt die Lebensgeschichten zweier Frauen aus dem Iran, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Behjat Moaali wird als drittes von neun Kindern eines wohlhabenden und ungewöhnlich liberalen Fabrikbesitzers geboren. Sie studiert Rechtswissenschaften, eröffnet eine Kanzlei in Teheran und setzt sich vor allem für die Rechte iranischer Frauen ein. So lernt sie die fast gleichaltrige Tara kennen, Tochter eines Schusters, in einem abgelegenen Bergdorf geboren und Analphabetin. Taras Versuch weiblicher Selbstbestimmung - sie weigert sich, sich nach dem Tod ihres ersten Mannes erneut verkuppeln zu lassen und wird aus der Gemeinschaft der Dorffrauen ausgeschlossen - endet in einer Katastrophe. Tara wird des Kindsmords angeklagt, Behjat Moaali ihre Pflichtverteidigerin. Doch sie kämpft vergeblich gegen die islamistische Rechtsprechung: Tara wird unter spektakulärem Medienrummel hingerichtet. Behjat selbst gerät zusehends unter politischen Druck und muß aus Teheran fliehen.
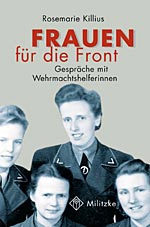
Frauen für die Front
Gespräche mit Wehrmachtshelferinnen
Dr. Rosemarie Killius, Militzke Verlag, 2003, S. 190, 19,90€, ISBN 978-3-8618-9296-0
Das Buch ist inzwischen vergriffen, aber bei der Autorin noch für 10 Euro zu erhalten. (Kontakt: Dr. Rosemarie Killius, Tel. 069-519248 oder Mail)
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Eine halbe Million deutscher Frauen zog im Gefolge der Wehrmacht in den Zweiten Weltkrieg. Ob als "Blitzmädchen" bei der Fernmeldetruppe, Hilfskanoniere an der Flak oder Bürokräfte im Stabdienst wurden sie in ganz Europa eingesetzt. Einige von ihnen hofften auf das große Abenteuer, andere wiederum folgten stolz dem Aufruf, "einen Soldaten für die Front frei zu machen". Sie wollten helfen, den Krieg zu gewinnen. Nach dem Ende des "Dritten Reiches" herrschte sowohl bei den Überlebenden als auch in der Forschung Schweigen über diesen Lebensabschnitt. Die Enttäuschung darüber, einem verbrecherischen Regime gedient zu haben, konnten viele ehemalige Wehrmachtshelferinnen nicht verarbeiten. So verdrängten sie die belastenden Erinnerungen.
Rosemarie Killius gelingt es, die Frauen auf subtile Weise zum Sprechen zu bringen, so dass bewegende Schicksale sichtbar werden.
Vorwort von Margarete Mitscherlich
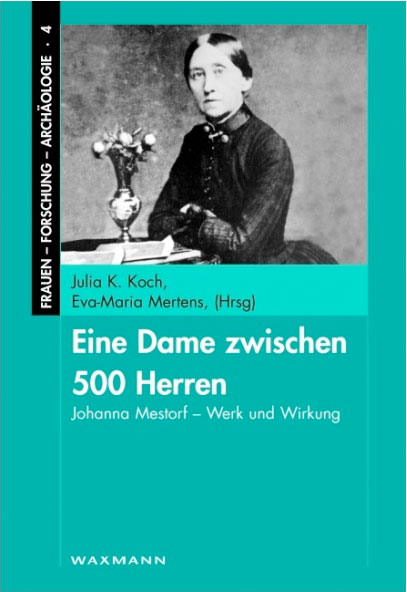
Eine Dame zwischen 500 Herren
Julia Katharina Koch, Eva-Maria Mertens (Hrsg.), Waxmann Verlag, 2002, S. 298, 19,50€, Frauen – Forschung – Archäologie, Band 4, ISBN 978-3-8309-1066-4
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
1899 wurde der Prähistorikerin Johanna Mestorf als einer der ersten Frauen Deutschlands der Professorentitel verliehen. Anlässlich des 100sten Jahrestages wurde an der Christian-Albrechts-Universität Kiel dieser bedeutenden Wissenschaftlerin gedacht und ihre herausragenden Leistungen mit einer Tagung gewürdigt, deren Beiträge hier erstmals veröffentlicht werden. Die 18 Artikel dieses Bandes spannen einen Bogen ausgehend von dem historischen Hintergrund über verschiedene biographische Stationen der Jubilarin bis hin zu weiteren Kolleginnen und Pionierinnen der Archäologie.

Biographien von Naturwissenschaftlerinnen des Deutschen Akademikerinnen Bundes e.V.
Eine Interviewreihe der DAB-Arbeitsgruppe Frauen in Naturwissenschaft und Technik als Festschrift des DAB zum 75-jährigen Jubiläums
Deutscher Akademikerinnenbund e.V., Eigenverlag, 2001, ISBN 300-0-0777-90
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In Interviews hat der Arbeitskreis "Frauen in Naturwissenschaften und Technik" die Lebenläufe von Frauen, die dem DAB angehören, nachgezeichnet. Sie haben allesamt eine naturwissenschaftlich technische Ausbildung und einen entsprechenden Beruf gewählt und berichten von den Schwierigkeiten, aber auch von den Höhepunkten, die eine solche Berufswahl ihnen gebarcht haben.
Die Publikation steht hier zum Download bereit.
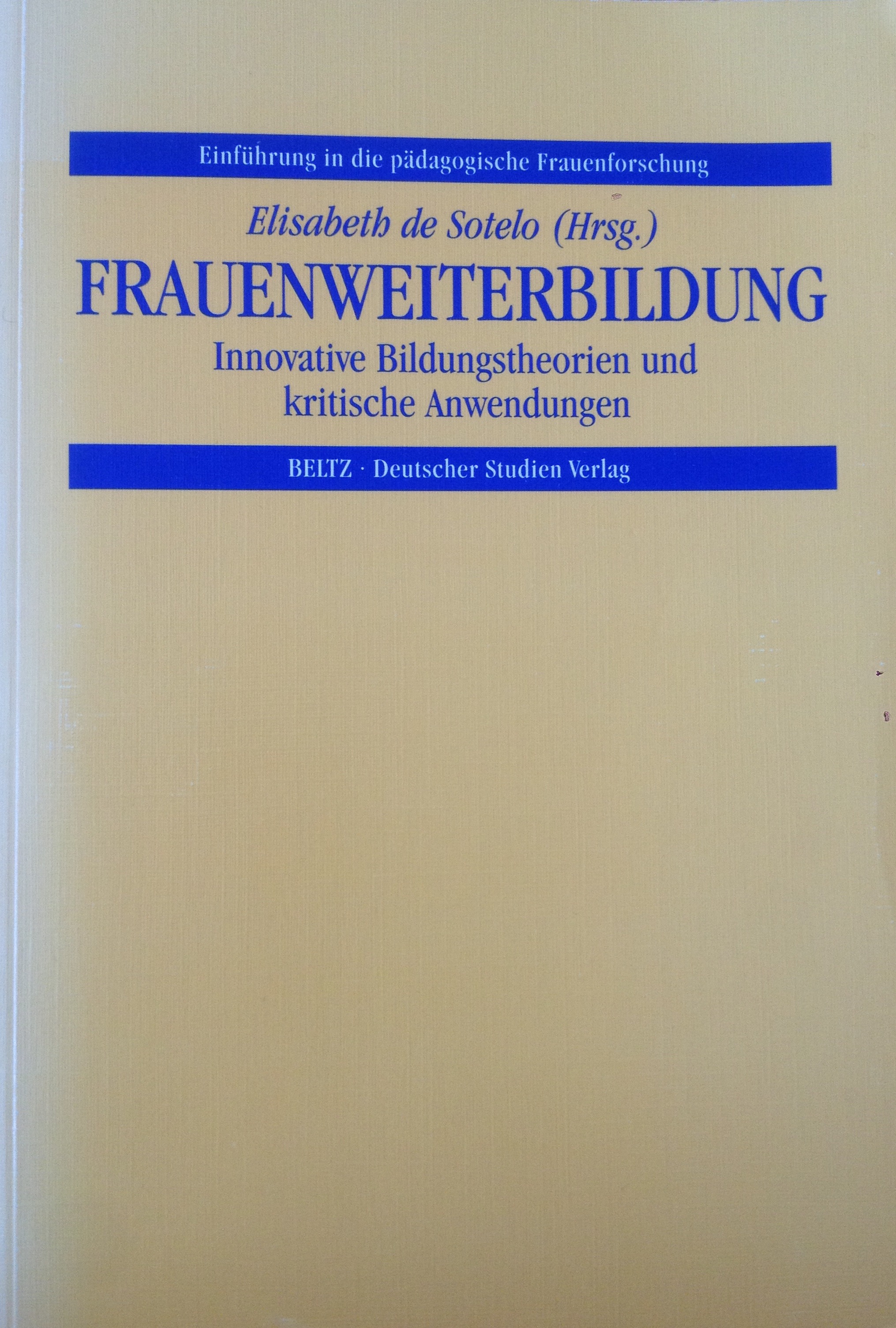
Frauenweiterbildung
Innovative Bildungstheorien und kritische Anwendungen
Elisabeth de Sotelo (Hrsg.), Beltz - Deutscher Studien Verlag, 2000, S. 243, 35€, ISBN 978-3-8927-1908-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In den 15 Beiträgen des Sammelbandes werden historische Traditionslinien, innovative Ansätze sowie beispielhafte Anwendungsbereiche dokumentiert und reflektiert. Den Ausgangspunkt der Überlegungen stellt die Kluft dar, die zwischen den zahlreichen Aktivitäten und Projekten im Bereich der Frauenbildung und dem vielfach konstatierten Mangel an theoretischer Durchdringung und systematischer Integration konzeptioneller Fragen besteht. Die Autorinnen untersuchen in facettenreicher Form Ziele, Inhalte, Orienrierunge und Verortungen der Frauenweiterbildung. Die besondere Leistung des Bandes liegt in der Zusammenstellung transdisziplinärer Zugänge, mittels derer eine theoretische Aufarbeitung der inzwischen etablierten Praxis der Frauenbildung in größerem Umfang ermöglicht wird. Analytische Dimensionen sind die nach wie vor aktuellen Polaritäten von "privat und politisch", "Gleichheit und Differenz der Geschlechter", "Individuum und soziale Struktur" sowie "Theorie und Praxis", wobei bereits erschlossene Potentiale und in Zukunft zu nutzende Chancen ebenso Berücksichtigung finden wie noch immer vorhandene Restriktionen im Hinblick auf die gesellschaftliche Gleichberechtigung.

Frauenkalender
Afsar Soheila Sattari, Köln, 2002, auf Persisch, ISBN 3-9807933-1-1; Köln, 2001, auf Persisch, ISBN 3-9807933-0-3;Teheran, 2000, auf Persisch, ISBN 3-9807933-2-X
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
In den Frauenkalendern wurden zu den jeweiligen Tagen sowohl bis Dato als auch historische Geschehnisse, die Frauen betrafen, eingetragen. Des Weiteren wurden die fortschrittlichen Aktivitäten der Frauen, landesweit und international, thematisch gegliedert und bei den Anlagen nach jedem Vierteljahr verfasst.
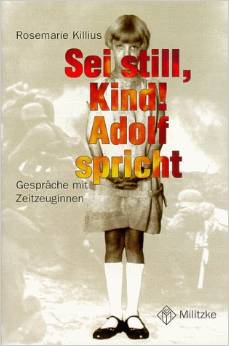
Sei still, Kind! Adolf spricht
Gespräche mit Zeitzeuginnen
Dr. Rosemarie Killius, Militzke Verlag, 2000, S. 253, 19,43€, ISBN 978-3-8618-9180-2
Das Buch ist inzwischen vergriffen, aber bei der Autorin noch für 10 Euro zu erhalten. (Kontakt: Dr. Rosemarie Killius, Tel. 069-519248 oder Mail)
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Die Historikerin Rosemarie Killius hat 26 Frauen nach ihrem Erleben des Zweiten Weltkrieges befragt. Prominente wie Margarethe Mitscherlich, Gisela May, Leonie Ossowski, Swetlana Alexijewitsch, Marianne Meyer-Kramer, geb. Goerdeler, Tisa von Schulenburg, aber auch Unbekannte eröffnen ungewöhnliche Einblicke. Die Frauen wurden verfolgt, gerettet, geduldet, übersehen und missbraucht. Ihre emotionalen und ganz Persönlichen Schilderungen aus unterschiedlichen Blickwinkeln faszinieren und erschüttern.
Besprechung von Peter Gingold:
"In einem Atemzug habe ich es gelesen, die Gespräche mit Zeitzeuginnen. Bereits von den ersten Seiten war ich gefesselt. Darin schildert Rosemarie Killius was sie eigentlich bewogen hatte, unterschiedlichste Frauen, die gegen den Nationalsozialismus kämpften, aufzusuchen - sogar bis an die Wolga ist sie gefahren, um dann die Gespräche mit ihnen in einem Buch festzuhalten."

Gleichstellung und Institution: Schule und Hochschule im Reformprozess
Eine Festschrift für Doris Knab
Susanne Diemer, Ruth Hagengruber, Otti Stein, Sigrid Wedig, Edit Kirsch-Auwärter, Sigrid Philipps (Hrsg.), Kimmerle, 1998, S. 254, 1€, ISBN 978-3-8929-5630-3
Mehr zum Inhalt Details ausblenden
Schulen und Hochschulen werden zunehmend mit kritischen Fragen aus Politik und Öffentlichkeit konfrontiert. Werden diese beiden Institutionen ihrem gesellschaftlichen Auftrag noch gerecht? Welche Massnahmen müssen getroffen werden, um die unübersehbare Krise zu überwinden? Einer der entscheidenden Prüfsteine für die Reformfähigkeit von Institutionen ist die Praxis von Frauenförderung und Gleichstellungspolitik. Die hier versammelten Beträge zur Wissenschaftspolitik sind ein Dank an die Wegbereiterin einer reform-orientierten, geschlechtergerechten Schul- und Hochschulpolitik in Baden-Württemberg: Professorin Dr. Doris Knab.